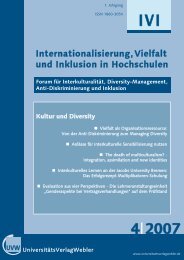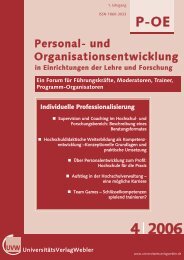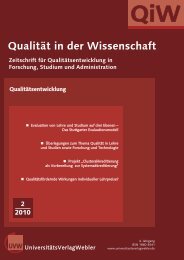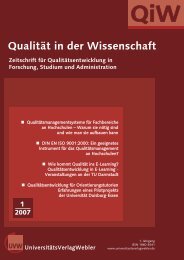Fo - UniversitätsVerlagWebler
Fo - UniversitätsVerlagWebler
Fo - UniversitätsVerlagWebler
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Fo</strong><br />
<strong>Fo</strong>rschungsgespräch mit P. Gauweiler<br />
sprache waren sicherlich große <strong>Fo</strong>rtschritte. Über die Ziele<br />
ist man sich im Wesentlichen einig, nicht nur im Unterausschuss,<br />
sondern auch im Bundestag.<br />
<strong>Fo</strong>: Haben Sie mal erwogen, sich mit der österreichischen<br />
und schweizerischen Wissenschaft und Politik kurz zu<br />
schließen, um sich auszutauschen und evtl. Maßnahmen zu<br />
koordinieren? Schließlich handelt es sich auch um ein Problem<br />
der deutschen Sprache, und die Interessen scheinen<br />
parallel zu liegen. Solche Probleme sind ja in der Vergangenheit<br />
in länderübergreifenden Gremien erörtert sowie<br />
das weitere Handeln inhaltlich abgestimmt worden.<br />
PG: Die Kooperation mit allen Ländern in denen (auch)<br />
deutsch gesprochen wird ist von hoher Bedeutung und<br />
muss unbedingt forciert werden. Wir haben identische<br />
sprachliche Interessen.<br />
<strong>Fo</strong>: Wir sollten nicht polemisch werden und sagen, dass im<br />
Falle von Industriespionage, z.B. dem Knacken und Ausspähen<br />
von Computersystemen in der Windenergie-Industrie,<br />
manche Kreise in den USA sehr wohl die deutsche<br />
Wissenschaftssprache geschätzt und genutzt haben.<br />
Aber es gibt weniger problematische Anlässe, die die deutsche<br />
Wissenschaftssprache für ausländische Wissenschaftler<br />
attraktiv machen könnten. Hier denke ich vor allem an das<br />
Potential derer, die alle mal in der Schule Deutsch gelernt<br />
haben, aber deren Kenntnis mangels Gebrauch eingeschlafen<br />
und eingerostet ist. Dieses große Potential zu wecken,<br />
fällt viel leichter, als Wissenschaftler völlig neu für diese<br />
Sprache zu gewinnen - obwohl das natürlich nicht vernachlässigt<br />
werden sollte, aber bereits zu den expliziten Zielen<br />
von DAAD und Goethe-Instituten zählt. Mit etwas Fantasie<br />
könnte man sich eine neue Initiative vorstellen, die sich auf<br />
diese Gruppe der „ehemaligen” deutsch sprechenden Wissenschaftler<br />
richtet. Neben weltweit verstreut lebenden<br />
Adressaten dieser Art kann ich mir Schwerpunkte dafür in<br />
Skandinavien, den baltischen Staaten, Mittelost-, Ost- und<br />
Südosteuropa vorstellen - überall dort, wo Deutsch als<br />
erste oder zweite Fremdsprache stärker verbreitet schon in<br />
der Schule gelernt worden war. Es bedarf jetzt eines zweiten<br />
Anreizes, da die Schulsprache nicht auf den späteren,<br />
jetzt ausgeübten Beruf als Wissenschaftler bezogen worden<br />
war. Hier wären auch die 17 Mio. Menschen einzubeziehen,<br />
die z.Z. Deutsch lernen. Sehen Sie da Handlungsmöglichkeiten<br />
der Politik, und als wie dringlich wird das von<br />
Ihnen eingestuft?<br />
PG: Durch einen Initiative zur Stärkung deutscher Schulen<br />
im Ausland und durch die Partnerschulinitiative haben wir<br />
in der letzten Wahlperiode bereits die Grundlage für Verbesserungen<br />
im Bereich des Spracherwerb gelegt. Die Einbeziehung<br />
oder Anziehung von ausländischen Studierenden,<br />
die bereits Kenntnisse in Deutsch erworben haben,<br />
kann nur gelingen, wenn die deutschen Universitäten den<br />
Nährboden bereiten, die deutsche Sprache noch intensiver<br />
kennenzulernen und damit Deutschland und seine Kultur<br />
besser zu verstehen. Darunter fallen auch die rund zwei<br />
Millionen Menschen, die derzeit an verschiedenen Hochschulen<br />
Deutsch als Fremdsprache erlernen. Außerdem<br />
sollten die Angebote Deutsch im Ausland zu lernen noch<br />
weiter gefördert und ausgebaut werden.<br />
<strong>Fo</strong> 3+4/2009<br />
<strong>Fo</strong>: Die folgende Frage habe ich auch der Präsidentin der<br />
HRK, Prof. Margret Wintermantel gestellt: Könnte es aus<br />
Sicht staatlicher Wissenschaftspolitik nicht sprach- und wissenschaftspolitisch<br />
sinnvoll sein, in Gebieten, in denen<br />
Deutschland tatsächlich Spitzenforschung aufzuweisen hat,<br />
einzelne deutschsprachige Fachzeitschriften und die Aufnahme<br />
von Beiträgen in ihre Hefte (oder online-Ausgaben)<br />
prestigeträchtig so zu unterstützen, dass es im Ausland<br />
immer wissenschaftlich ergiebiger, d.h. attraktiver wird, auf<br />
solche Publikationen zuzugreifen? Dies könnte durch eigene<br />
englischsprachige Kurzartikel über diese Spitzenforschung<br />
in den bisher führenden US-amerikanischen Zeitschriften<br />
mit Verweis auf die ausführlichen Berichte in der<br />
deutschen Zeitschrift geradezu angereizt werden. So oder<br />
in Varianten könnten Etappenziele einer aktiven Sprachenpolitik<br />
mit strategischer Komponente aussehen. Die deutschen<br />
Fachgemeinschaften haben offensichtlich nicht den<br />
Organisationsgrad und agieren dem Anschein nach obendrein<br />
mit einer gewissen Wissenschaftsnaivität, was diese<br />
Fragen angeht. Man muss sich nur die Politik der anderen<br />
Seite einschließlich der spezifischen Organisation der Impactpunkte<br />
ansehen, um zu begreifen, dass dort wenig dem<br />
Zufall überlassen wurde ...<br />
PG: Dies halte ich für eine denkbare Initiative, Deutsch als<br />
Wissenschaftssprache stärker in der universitären und der<br />
wissenschaftlichen Diskussion zu platzieren.<br />
<strong>Fo</strong>: Diesen Punkt habe ich auch der VW-Stiftung gegenüber<br />
angesprochen: Auch ohne alle Verschwörungstheorien und<br />
Verdächtigungen des wissenschaftlichen Imperialismus passen<br />
die von den USA ausgehenden Strategien und Einzelmaßnahmen<br />
erstaunlich gut zusammen und passen auch<br />
gut zu der Debatte um brain gain, der dann doch in die<br />
Nähe eines wissenschaftlichen Imperialismus gerückt wird.<br />
Halten wir uns nicht mit der Erörterung von vermuteter Absicht<br />
auf, sondern konzentrieren uns auf die <strong>Fo</strong>lgen. Diese<br />
<strong>Fo</strong>lgen sind nicht im deutschen Interesse, weder kulturell,<br />
wissenschaftlich, noch wirtschaftlich, also müssten Gegenstrategien<br />
entwickelt werden, um den Trend wieder umzukehren.<br />
Damit ist nicht gemeint, Deutsch nun seinerseits<br />
zur lingua franca der Wissenschaft zu machen (was ohnehin<br />
vergeblich wäre). Aber ihr den ihr gebührenden Platz nach<br />
Quantität und vor allem Qualität im deutschsprachigen<br />
Raum erzielter wissenschaftlicher Ergebnisse zu verschaffen,<br />
wäre ein plausibles Ziel.<br />
PG: Auf jeden Fall. Das Gegenstück zu diesem wissenschaftlichen<br />
Imperialismus war die sprachliche Anpassungsbereitschaft<br />
und Einebnungsbereitschaft bei uns. Deutsch als<br />
Wissenschaftssprache wurde immer weiter zurückgedrängt.<br />
Was wir brauchen, ist zumindest eine rezeptive Mehrsprachigkeit<br />
unter den Wissenschaftlern, am wichtigsten wird<br />
aber der Wille unserer Wissenschaftler sein, wieder der<br />
deutschen Sprache größeres Gewicht im internationalen<br />
Rahmen zu verleihen.<br />
<strong>Fo</strong>: Herr Dr. Gauweiler, wir danken Ihnen für diese Stellungnahme.<br />
Die Fragen für „<strong>Fo</strong>rschung” stellte Wolff-Dietrich Webler.<br />
III