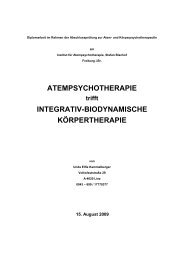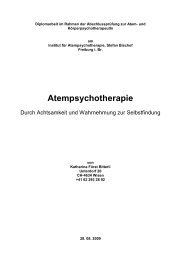Ich hole dich dort ab, wo du stehst. - Institut für Atem ...
Ich hole dich dort ab, wo du stehst. - Institut für Atem ...
Ich hole dich dort ab, wo du stehst. - Institut für Atem ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ich</strong> <strong>hole</strong> <strong>dich</strong> <strong>dort</strong> <strong>ab</strong>, <strong>wo</strong> <strong>du</strong> <strong>stehst</strong>. 15. Juli 2010<br />
Tiefer als die konfliktzentrierte Übertragung liegt die jeweilige Grundübertragung, die<br />
Rückschlüsse zulässt auf die seelische Entwicklungsebene, auf der das jeweilige<br />
Beziehungsverhalten angesiedelt werden kann. Rosenberg unterscheidet hier drei<br />
Phasen der Übertragungsbeziehung (vgl. Rosenberg, 1996):<br />
In der sog. magischen Phase (sie entspricht der symbiotischen oder Bin<strong>du</strong>ngsphase<br />
des Kleinkindes) erwartet der Klient vom Therapeuten eine „magische“ Lösung<br />
seiner Probleme, <strong>für</strong> die weder Zeit, noch Anstrengung, noch Überprüfung der<br />
Realität erforderlich sind. Er hat blindes Vertrauen in die Kräfte des Therapeuten<br />
(oder des <strong>Atem</strong>s). Wird dieses Vertrauen notgedrungen nach einiger Zeit enttäuscht,<br />
können die Gefühle des Klienten in Frustration oder Wut umschlagen.<br />
In der sog. Anlehnungsphase (sie entspricht der Loslösungs- oder<br />
Indivi<strong>du</strong>ationsphase, in der das Kind auf die Spiegelung <strong>du</strong>rch die Mutter angewiesen<br />
ist) ist das Selbstgefühl des Klienten zerbrechlich. Er weiß zwar, dass er<br />
Verant<strong>wo</strong>rtung <strong>für</strong> sich übernehmen muss, braucht <strong>ab</strong>er noch die Unterstützung des<br />
Therapeuten, der über anerkennende und angemessene Spiegelung das<br />
Selbstgefühl des Klienten halten muss.<br />
Erst in der dritten, der sog. selbstsicheren Phase ist das Selbstgefühl des Klienten so<br />
st<strong>ab</strong>il, dass er zunehmend <strong>für</strong> sich selbst sorgen und sich in seinen positiven wie<br />
auch seinen problemhaften Seiten wahrnehmen kann. Er hat keine Angst mehr, in<br />
seiner Andersartigkeit <strong>ab</strong>gelehnt zu werden und tritt aus der Übertragungsbeziehung<br />
in eine reale Beziehung zum Therapeuten. Erst hier ist im Grunde die Ebene einer<br />
Lehrer-Schüler Beziehung erreicht, also die Ebene eines weitgehend störungsfreien<br />
pädagogischen Arbeitens.<br />
6.2. Sammeln diagnostischer Hinweise zur Klärung der <strong>Ich</strong>-Kraft<br />
Wie in der Psychotherapie steht auch in der APT zu Beginn der Arbeit eine<br />
Diagnosestellung (griech. diagnossi: <strong>du</strong>rchforschen, Erkenntnis gewinnen) als<br />
Orientierung <strong>für</strong> das konkrete Vorgehen im Sinne verant<strong>wo</strong>rtlichen therapeutischen<br />
Handelns. Sie ergibt sich aus der Wahrnehmung des Bestehenden im somatischen<br />
und psychischen Bereich (einzelne Erscheinungen / Symptome) und dessen<br />
Verbin<strong>du</strong>ng mit dem lebensgeschichtlichen Hintergrund (Anamnese).<br />
Bei <strong>Atem</strong>therapeuten existieren gegen den Begriff der Diagnose oft Widerstände.<br />
Diese sind meines Erachtens dann berechtigt, wenn Diagnose mit der realen Gefahr<br />
der Abwertung verbunden wird. Die diagnostische Vermutung dient jedoch der<br />
Orientierung und Differenzierung und muss immer wieder an den Wahrnehmungen<br />
überprüft werden. Außerdem ist zu beachten, dass das Auftreten bestimmter,<br />
beispielsweise narzisstischer Symptome noch lange nicht das Krankheitsbild einer<br />
narzisstischen Persönlichkeitsstörung ergibt. So verstanden sind die diagnostischen<br />
Beobachtungen eine wichtige Voraussetzung <strong>für</strong> ein dem Klienten angemessenes<br />
atemtherapeutisches Angebot.<br />
Folgende Fragestellungen können helfen, einen Wahrnehmungsraum <strong>für</strong> die <strong>Ich</strong>-<br />
Kraft bzw. das Strukturniveau des Klienten zu eröffnen:<br />
- Welchen konkreten Abstand zum Therapeuten möchte der Klient einnehmen?<br />
Sucht er unverhältnismäßig viel Nähe (symbiotische Tendenz) oder sehr viel<br />
Distanz, weil Nähe angstbesetzt ist?<br />
- Kann der Klient die Wahrnehmung aufrechterhalten oder hat er<br />
Wahrnehmungslöcher („<strong>Ich</strong> weiß nicht.“)?<br />
Abschlussarbeit: Brigitte Maas 18