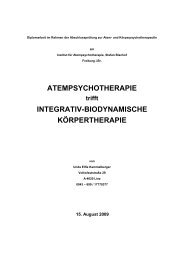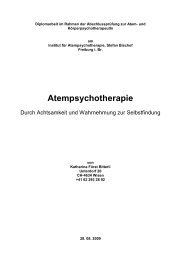Ich hole dich dort ab, wo du stehst. - Institut für Atem ...
Ich hole dich dort ab, wo du stehst. - Institut für Atem ...
Ich hole dich dort ab, wo du stehst. - Institut für Atem ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Ich</strong> <strong>hole</strong> <strong>dich</strong> <strong>dort</strong> <strong>ab</strong>, <strong>wo</strong> <strong>du</strong> <strong>stehst</strong>. 15. Juli 2010<br />
Zeit wieder hervorbrechen. (Das gute und das böse Objekt konnten nicht in einem<br />
einheitlichen Bild vereint werden.)<br />
Borderline-Verletzte leben mit einer hohen inneren Spannung und starken<br />
Gefühlsschwankungen. Sie erleben sich entweder in zuviel Nähe, die einhergeht mit<br />
der Angst verschlungen zu werden, oder in zuviel Distanz mit der Angst verlassen zu<br />
werden. Ihr zentrales Konfliktthema ist das der Existenzberechtigung.<br />
Das mittlere Strukturniveau entspricht der narzisstischen Störung (vgl. Bischof,<br />
2003). Die zentrale Angst dieser Menschen ist die Angst vor Objektverlust, d.h. vor<br />
Verlust der primären Bezugsperson. Die Mutter/Bezugsperson signalisierte dem<br />
Kind: „Du darfst leben, <strong>ab</strong>er bist mir nichts wert!“ (Maaz, 2003, S. 742) Maaz spricht<br />
von „Muttermangel“. Der narzisstisch verletzte Mensch kreist um das Thema der<br />
Wertschätzung und des Selbstwertes und schwankt in seinem Gefühlsleben<br />
zwischen Grandiosität und Minderwertigkeit. Er konnte aufgrund mangelnder<br />
Spiegelung, besonders in Phasen hoher Frustration, kein st<strong>ab</strong>iles und authentisches<br />
Selbstgefühl oder Identitätserleben entwickeln.<br />
Beide Strukturniveaus sind geprägt <strong>du</strong>rch eine strukturelle <strong>Ich</strong>-Schwäche, die in<br />
Defiziten innerhalb der ersten drei Lebensjahre wurzelt.<br />
Das höhere Strukturniveau entspricht der neurotischen Störung. Hier ist das Kind<br />
groß ge<strong>wo</strong>rden mit der Botschaft: „Du darfst leben und bist mir auch etwas wert,<br />
wenn <strong>du</strong> so bist, wie ich <strong>dich</strong> brauche.“ (Maaz, 2003, S. 742). In diesem<br />
Zusammenhang spricht Maaz von „Muttervergiftung“. Das Leben kreist um die Angst<br />
vor Liebesverlust.<br />
Die <strong>Ich</strong>-Struktur ist hier deutlich st<strong>ab</strong>iler. Man spricht nicht mehr von struktureller <strong>Ich</strong>-<br />
Schwäche, sondern von funktionaler <strong>Ich</strong>-Störung. Während ein Mensch mit<br />
niedrigem Strukturniveau ständig in Gefahr ist, von seinen Emotionen<br />
überschwemmt zu werden, kann ein Mensch mit neurotischem Strukturniveau<br />
verdrängen, d.h. sein <strong>Ich</strong> ist in der Lage, bedrohliche Gefühlsanteile dauerhaft in das<br />
Unbewusste zu verbannen. Einerseits kann er sich da<strong>du</strong>rch emotional st<strong>ab</strong>ilisieren,<br />
andererseits führt diese dauerhafte Abwehrleistung möglicherweise zu Fehlverhalten<br />
und Realitätsverzerrungen im Alltag.<br />
Je niedriger das Strukturniveau, desto größer also die Gefahr, dass unkontrollierbare<br />
Emotionen auftauchen, die unbewusst aus frühkindlichen Konfliktsituationen auf die<br />
gegenwärtige Beziehungssituation übertragen werden und zu Problemen führen.<br />
Mit körpertherapeutischen Interventionen begeben wir uns körperemphatisch und <strong>du</strong>rch die<br />
Art und Weise des Körperkontaktes und der Berührung in frühe Interaktionserfahrungen des<br />
Patienten. Das heißt, wir können erlebte Bedrohung, Ablehnung und Verlassenheit, erlittene<br />
Gewalterfahrungen reaktivieren und ungestillte Verschmelzungswünsche und<br />
Zuwen<strong>du</strong>ngsbedürfnisse wieder beleben. (Maaz, 2007, S. 742f.).<br />
Maaz folgert daher:<br />
Wenn man als Therapeut aktiv wird und Körperkontakt anbietet oder zulässt, muss so gut als<br />
möglich gesichert sein, dass der Patient Selbst und Objekt differenzieren kann, dass er den<br />
Therapeuten nicht mehr als „Erlöser“ oder „Täter“ verkennt und dass er reaktivierte Affekte<br />
nicht mehr in der Übertragung auf den Therapeuten richtet, sondern so energetisch <strong>ab</strong>führen<br />
lernt, dass der Therapeut nun als „Dritter“ angenommen werden kann. Der Therapeut wird<br />
dann zum partnerschaftlichen Begleiter mit technischem Expertenwissen, er wird zu einem<br />
Gegenüber, der einen tieferen (oder höheren) Sinn <strong>für</strong> die therapeutische Arbeit verkörpert<br />
(z.B. Gesundheit, Lebendigkeit, soziale und globale Bezogenheit, Sinnerfahrung)... (Maaz,<br />
2007, S. 743).<br />
<strong>Ich</strong> denke, in der so beschriebenen Rolle des partnerschaftlichen Begleiters möchten<br />
wir uns als <strong>Atem</strong>pädagogen und <strong>Atem</strong>therapeuten gerne wiederfinden.<br />
Abschlussarbeit: Brigitte Maas 32