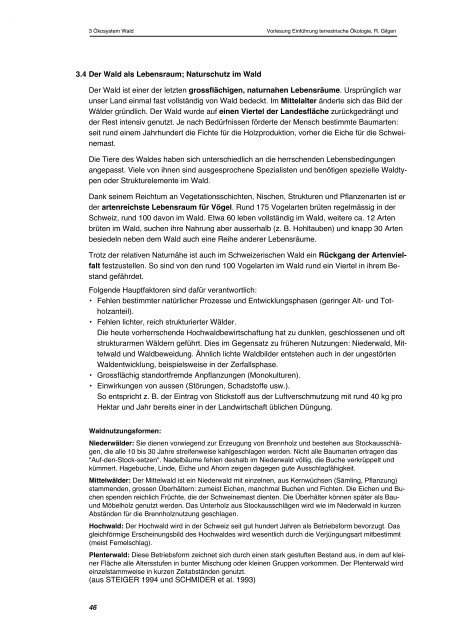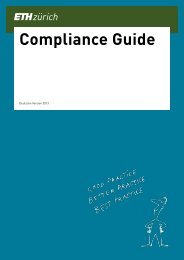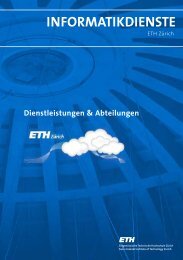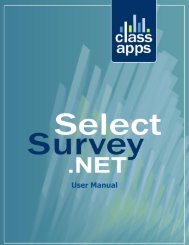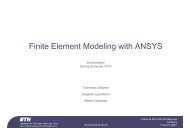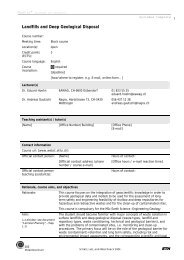Skript Terrestrische Ökologie
Skript Terrestrische Ökologie
Skript Terrestrische Ökologie
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen3.4 Der Wald als Lebensraum; Naturschutz im WaldDer Wald ist einer der letzten grossflächigen, naturnahen Lebensräume. Ursprünglich warunser Land einmal fast vollständig von Wald bedeckt. Im Mittelalter änderte sich das Bild derWälder gründlich. Der Wald wurde auf einen Viertel der Landesfläche zurückgedrängt undder Rest intensiv genutzt. Je nach Bedürfnissen förderte der Mensch bestimmte Baumarten:seit rund einem Jahrhundert die Fichte für die Holzproduktion, vorher die Eiche für die Schweinemast.Die Tiere des Waldes haben sich unterschiedlich an die herrschenden Lebensbedingungenangepasst. Viele von ihnen sind ausgesprochene Spezialisten und benötigen spezielle Waldtypenoder Strukturelemente im Wald.Dank seinem Reichtum an Vegetationsschichten, Nischen, Strukturen und Pflanzenarten ist erder artenreichste Lebensraum für Vögel. Rund 175 Vogelarten brüten regelmässig in derSchweiz, rund 100 davon im Wald. Etwa 60 leben vollständig im Wald, weitere ca. 12 Artenbrüten im Wald, suchen ihre Nahrung aber ausserhalb (z. B. Hohltauben) und knapp 30 Artenbesiedeln neben dem Wald auch eine Reihe anderer Lebensräume.Trotz der relativen Naturnähe ist auch im Schweizerischen Wald ein Rückgang der Artenvielfaltfestzustellen. So sind von den rund 100 Vogelarten im Wald rund ein Viertel in ihrem Bestandgefährdet.Folgende Hauptfaktoren sind dafür verantwortlich:• Fehlen bestimmter natürlicher Prozesse und Entwicklungsphasen (geringer Alt- und Totholzanteil).• Fehlen lichter, reich strukturierter Wälder.Die heute vorherrschende Hochwaldbewirtschaftung hat zu dunklen, geschlossenen und oftstrukturarmen Wäldern geführt. Dies im Gegensatz zu früheren Nutzungen: Niederwald, Mittelwaldund Waldbeweidung. Ähnlich lichte Waldbilder entstehen auch in der ungestörtenWaldentwicklung, beispielsweise in der Zerfallsphase.• Grossflächig standortfremde Anpflanzungen (Monokulturen).• Einwirkungen von aussen (Störungen, Schadstoffe usw.).So entspricht z. B. der Eintrag von Stickstoff aus der Luftverschmutzung mit rund 40 kg proHektar und Jahr bereits einer in der Landwirtschaft üblichen Düngung.Waldnutzungsformen:Niederwälder: Sie dienen vorwiegend zur Erzeugung von Brennholz und bestehen aus Stockausschlägen,die alle 10 bis 30 Jahre streifenweise kahlgeschlagen werden. Nicht alle Baumarten ertragen das"Auf-den-Stock-setzen". Nadelbäume fehlen deshalb im Niederwald völlig, die Buche verkrüppelt undkümmert. Hagebuche, Linde, Eiche und Ahorn zeigen dagegen gute Ausschlagfähigkeit.Mittelwälder: Der Mittelwald ist ein Niederwald mit einzelnen, aus Kernwüchsen (Sämling, Pflanzung)stammenden, grossen Überhältern: zumeist Eichen, manchmal Buchen und Fichten. Die Eichen und Buchenspenden reichlich Früchte, die der Schweinemast dienten. Die Überhälter können später als BauundMöbelholz genutzt werden. Das Unterholz aus Stockausschlägen wird wie im Niederwald in kurzenAbständen für die Brennholznutzung geschlagen.Hochwald: Der Hochwald wird in der Schweiz seit gut hundert Jahren als Betriebsform bevorzugt. Dasgleichförmige Erscheinungsbild des Hochwaldes wird wesentlich durch die Verjüngungsart mitbestimmt(meist Femelschlag).Plenterwald: Diese Betriebsform zeichnet sich durch einen stark gestuften Bestand aus, in dem auf kleinerFläche alle Altersstufen in bunter Mischung oder kleinen Gruppen vorkommen. Der Plenterwald wirdeinzelstammweise in kurzen Zeitabständen genutzt.(aus STEIGER 1994 und SCHMIDER et al. 1993)46