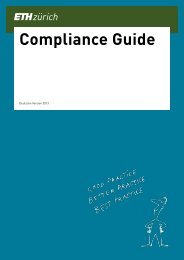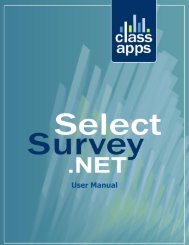Skript Terrestrische Ökologie
Skript Terrestrische Ökologie
Skript Terrestrische Ökologie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorlesung Einführung ÖkologieTeil terrestrische ÖkologieRené Gilgen, Dr.sc.nat.Studiengänge Umweltingenieurwissenschaften, Geomatik und Planung<strong>Skript</strong> Herbstsemester 2012Inhaltsverzeichnis1 Einleitung, Begriffe 22 Das Ökosystem 82.1 Funktionelle Gliederung der Organismengruppen; Nahrungsketten 102.2 Abiotische Umweltfaktoren 112.3 Biotische Faktoren 112.3.1 Ökologische Interaktionen 112.4 Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora 202.5 Sukzession und Mosaikzyklus-Konzept 302.6 Produktion und Stabilität 332.7 Zusammenfassung terrestrische Ökosysteme, allgemeiner Teil 383 Ökosystem Wald 383.1 Sommergrüne Laubwälder 383.2 Mitteleuropäische Waldvegetation in der Schweiz 393.3 Höhenstufen der Vegetation der Schweiz 423.4 Der Wald als Lebensraum; Naturschutz im Wald 463.5 Der Auerhahn (autökologische Betrachtungen) 514 Vergleich Wald / Schlagfläche 535 Landschaftsentwicklung 556 Naturschutz 586.1 Artenentwicklung 586.2 Biotopinseln, Inseltheorie 596.3 Rote Listen 636.4 Blaue Liste 697 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) 707.1 Was heisst naturnahe Gestaltung? 707.2 Rechtliche Grundlagen und Instrumente 717.3 Planen und Projektieren 737.4 Massnahmen (Beispiele) 768 Einige Fragen 839 Literatur 85Anhang: Antwortblätter1
1 Einleitung, Begriffe Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen1 Einleitung, BegriffeZielsetzungen Vorlesung Einführung Ökologie; Teil terrestrische Ökologie• Grundkenntnisse der Strukturen und Funktionen der Biozönosen (Lebensgemeinschaften)in terrestrischen Ökosystemen vermitteln. (Terrestrisch: zum Festland gehörig, auf demFestland entstanden).• Aufzeigen der Interaktionen von Physik, Chemie und Biologie in natürlichen Lebensräumen.• Grundkenntnisse der Natur- und Landschaftschutzanliegen vermitteln.• Aufzeigen von ingenieurbiologischen Möglichkeiten für naturnahe Gestaltungsmassnahmen.Literaturauswahl (vollständige Literaturangabe vgl. Kapitel 9)BICK H., 1998: Grundzüge der Ökologie. 3. überarb. und erg. Auflage. Gustav Fischer VerlagStuttgart, Jena, Lübeck, Ulm. S. 368.ELLENBERG H., 1986: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 4., verbesserte Aufl. UlmerStuttgart. S. 989.HEINRICH D. und HERGT M., 1998: Ökologie. dtv-Atlas. 4. Aufl. S. 287.LANDOLT E., 1984: Unsere Alpenflora. 5., vollständig neu bearb. Aufl. Verlag des SAC. S.318 + 120 Tafeln.SCHERF G., 1997: Wörterbuch Biologie. dtv München. S. 512.Definition ÖkologieÖkologie (griech. oikos = Wohnung, Haus, Platz um zu leben, Haushalt; logos = Lehre).Ökologie ist die Wissenschaft von den wechselseitigen Beziehungen zwischen Organismenund ihrer Umwelt. Erstmalig definiert wurde Ökologie 1866 von dem Zoologen Ernst Haeckel(vgl. Vorlesung Einf. Ökologie, Teil Prof. Zeyer). Wissenschaftliche Aussagen und Fragestellungen,die dem neuen Begriff unterzuordnen wären, gab es auch schon wesentlich früher. Diealte Naturgeschichte enthielt durchaus ökologische Aussagen im heutigen Sinne, z. B.:• Beschreibung von Massenvermehrungen schadfrassverursachender Heuschrecken in denfrüheren Hochkulturen des vorderen Orients• Aussagen von Aristoteles (384-322 v. Chr.) über Beziehungen von Tieren zu ihrer Umwelt• Naturkunde von C. Plinus Secundus d. Ä. (23-79 n. Chr.) mit Angaben über den Sommerschlafvon Schnecken des Mittelmeergebietes• Charles Darwin (1809-1882): "survival of the fittest"; Kampf ums Dasein sowie Studie überBiologie der Regenwürmer und ihren Anteil an der Bodenbildung, die als Muster einer ökologischenArbeit gelten kann; der Begriff Ökologie wird aber noch nicht benutzt.Bekanntheitsgrad und Wertschätzung der Ökologie waren um 1960 noch sehr gering. Die Dingebegannen sich erst Anfang der 70er Jahre zu ändern, als die Auswirkungen von Umweltverschmutzungenweltweit immer sichtbarer wurden und natürliche Hilfsquellen (Ressourcen)knapper wurden. Die Ökologie kann also nicht nur eine Wissenschaft der Natur sein – Natur imstrengsten Sinne des Wortes –, da es etwas von Eingriffen des Menschen Unabhängiges aufder Erde kaum noch gibt. => Der Mensch als biotischer Faktor im Ökosystem.1971 wurde von der UNESCO das Programm "Mensch und Biosphäre" ("Man and the biosphere"= MAB) gestartet. Wesentlicher Inhalt dieses Programms ist die Frage nach den Rückwirkungender menschlichen Tätigkeit auf die verschiedenen Organismen.2
1 Einleitung, Begriffe Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenDie Ökologie ist wertfrei. Sie schafft aber wissenschaftliche Grundlagen für Umwelt- und Naturschutzmassnahmen.BegriffeAutökologie: Teilgebiet der Ökologie. Untersucht die Beziehungen eines Einzelorganismuseiner Art zu den verschiedenen Umweltfaktoren; insbesondere stellt sie fest, unter welchenBedingungen der Organismus lebensfähig ist und von welcher Art seine Angepasstheit an bestimmteGegebenheiten ist.Demökologie (Populationsökologie): Teilgebiet der Ökologie. Untersucht die Entwicklungenund Veränderungen von Populationen in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen.Population: Gesamtheit der Individuen einer Art in einem bestimmten Raum.Synökologie: Teilgebiet der Ökologie. Untersucht die Wechselbeziehungen zwischen Gesellschaftenund der Umwelt. Untersucht Biozönosen (Lebensgemeinschaften) in Ökosystemen:z. B. Aufbau und Struktur der Tiergemeinschaften in einem Wald.ÖkologieAutökologie(Wechselwirkungen zwischeneinem Individuum einer Artund seiner Umwelt)Demökologie= Populationsökologie(Wechselwirkungen zwischeneiner Population und ihrerUmwelt)Synökologie(Wechselwirkungen zwischenden Organismen einer Lebensgemeinschaftund denBeziehungen zu ihrer Umwelt)(aus KNODEL u. KULL 1981)3
1 Einleitung, Begriffe Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenGeobotanik: (griech. geos = Erde, im weiteren Sinne auch Welt, Umwelt). Die Geobotanik befasstsich mit den Pflanzen und ihren Beziehungen zur Umwelt.• Warum wächst eine Pflanze an einem bestimmten Ort?• Voraussetzung: Kenntnis der Systematik, Morphologie und Physiologie der Pflanzen. Kenntnissein Klima- und Bodenkunde (Umweltbedingungen) sowie über biotische Faktoren undüber die Verbreitung der Art (früher sowie heute).Teilgebiete Geobotanik: Pflanzengeographie, -geschichte, -ökologie, Vegetationskunde =>Floristische Geobotanik (Arealkunde), Historische Geobotanik, Ökologische Geobotanik (Standortlehre),Pflanzensoziologie.Vegetationskunde oder Pflanzensoziologie: Teilgebiet der Geobotanik => VegetationskundlicheGeobotanik. Beschäftigt sich mit der Erforschung und Beschreibung der Artenzusammensetzungund Verbreitung von Pflanzengesellschaften sowie ihrer Beziehung zur Umwelt.Flora: Sämtliche Pflanzenarten eines bestimmten Gebietes oder eines bestimmten Zeitabschnitts.Bücher, die die Gesamtheit der Pflanzensippen in einem bestimmten Gebiet aufzählen,werden ebenfalls als "Floren" bezeichnet.Vegetation: Pflanzendecke, Pflanzenkleid. Gesamtheit aller Pflanzengesellschaften eines Gebietes.=> Edelweiss (Leontopodium alpinum), Kirschbaum (Prunus avium) und Massliebchen bzw.Gänseblümchen (Bellis perennis) gehören zur Flora und sind Teil der Vegetation. Trockenwiesen,Moore und Wald sind Vegetationsbegriffe.Standort: Ort mit seinen Umweltfaktoren (auch Standortfaktoren genannt). Klima (klimatischeFaktoren), Boden (edaphische Faktoren) und Lebewesen (biotische Faktoren) sind Standortfaktoren.Sumpf, Waldrand, Südhang und Trockenbord sind Standortsbezeichnungen. Standort istein Begriff der Geobotanik und bezieht sich vor allem auf Pflanzen. Für Tiere wird eher die synonymeBezeichnung Habitat verwendet (=> Lebens- und Wohnraum von Tieren mit seinenUmweltfaktoren; z. B. der Wald als Habitat des Eichhörnchens).Standort und Habitat meinen stärker die physikalisch-chemischen bzw. meteorologischenGegebenheiten eines Gebietes, Biotop (Lebensraum) bezeichnet eher ein topographischesGebiet, in dem bestimmte Umweltfaktoren wirken (z.B. Teich).Fundort: Ort, an dem eine Pflanze gefunden wurde. Rein geographische Bezeichnung(=> durch Koordinaten eindeutig bestimmt). Als Areal einer Art (Verbreitungsgebiet) wird derRaum bezeichnet, der von den Individuen einer Art (also der Population) besiedelt wird; es istalso gewissermassen die Summe der Fundorte.Weitere Begriffe siehe <strong>Skript</strong> Vorlesung "Einführung aquatische Ökologie", Teil Prof. Zeyer.4
1 Einleitung, Begriffe Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenÖkogramme aus SCHMIDER et al. (1993)5
1 Einleitung, Begriffe Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenÖkogramme aus SCHMIDER et al. (1993)6
1 Einleitung, Begriffe Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus LAUBER und WAGNER 1996)7
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2 Das ÖkosystemDefinition aus BICK 1998: Ein Ökosystem ist eine funktionelle Einheit der Biosphäre, d.h. einWirkungsgefüge aus Organismen und unbelebten natürlichen sowie anthropogenen Umweltfaktoren,die untereinander und mit ihrer Umgebung in energetischen, stofflichen und informatorischenWechselwirkungen stehen (vgl. Abb. 1.4).Definition aus LANDOLT, Vorlesungsskript Einführung in die Geobotanik: Die an einem Ortbefindlichen Lebewesen bilden unter der Einwirkung der Umweltfaktoren ein kompliziertesHaushaltsystem von Stoffkreisläufen und Energieflüssen, das sich selbst reguliert. Ein solchesSystem wird Ökosystem genannt.Bei ökologischen Untersuchungen müssen oft viele verschiedene Lebewesen und Lebensformenberücksichtigt werden. Deshalb sind für die Betrachtung von ökologischen Systemen gewisseArt- und Formenkenntnisse nötig.Organismus Population Lebensgemeinschaft= Biozönoseunbelebte UmweltÖkosystem(aus BICK 1998)8
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BAUER E.W., 1982)9
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2.1 Funktionelle Gliederung der Organismengruppen; NahrungskettenProduzenten, Primärproduzenten, Erzeuger = Autotrophe Organismengruppe innerhalb derbiotischen Kompartimente eines Ökosystems, die durch Photo- oder Chemosynthese aus anorganischemMaterial energiereiches organisches Material aufbaut (Primärproduktion). Zu denProduzenten gehören die grünen Pflanzen und einige Mikroorganismen.Konsumenten, Verbraucher, Makrokonsumenten = heterotrophe Organismengruppe innerhalbder biotischen Kompartimente eines Ökosystems, deren Mitglieder von den durch dieProduzenten aufgebauten Stoffen leben.Primärkonsumenten: alle Pflanzenfresser => Phytophage, Konsumenten 1. Ordnung.Sekundärkonsumenten: Ernähren sich von Pflanzenfressern => Zoophage, Konsumenten 2.Ordnung. Tertiärkonsumenten: Ernähren sich von anderen Zoophagen => Zoophage, Konsumenten3. Ordnung.Destruenten, Zersetzer, Reduzenten, Mikrokonsumenten = heterotrophe Organismengruppeinnerhalb der biotischen Kompartimente eines Ökosystems, die totes organisches Materialzu einfacheren Stoffen abbauen und schliesslich in seine mineralischen Kompartimente zerlegen(Mineralisation). Bakterien und Pilze.Saprophyt = (G sapros = faul, verfault; G phyton = Pflanze, Gewächs). Fäulnisbewohner. Totmaterialnutzer.Bakterien und Pilze, die ihre Nahrung aus toten, bereits in Zersetzung befindlichenSubstraten (Ausscheidung lebender oder Überreste abgestorbener Tiere und Pflanzen)aufnehmen und enzymatisch stufenweise bis zu den anorganischen Ausgangsstoffen abbauen.Saprophyten sind im Stoffhaushalt der Erde von grosser Bedeutung, da sie abgestorbenesorganisches Material remineralisieren und die "biologische Selbstreinigung" verschmutztenWassers besorgen. Gegenüber den meisten Tieren haben die Saprophyten eine viel bessereenzymatische Ausstattung, die z. B. gestattet, schwer abbaubare Substrate wie Celluloseund Lignin zu verarbeiten. Die besondere Rolle der Saprophyten legt es nahe, sie als eigeneGruppe der heterotrophen Organismen aufzufassen: Destruenten.Saprophage, Detritivore: Tiere, die sich von abgestorbenen, bereits in Zersetzung befindlichenorganischen Substanzen ernähren; sie repräsentieren Teile der Konsumenten, aber auchder Destruenten eines Ökosystems. Saprophage leben v. a. im Boden (z. B. Regenwürmer,Collembolen = Springschwänze) und auf dem Grund von Gewässern (z. B. Nematoden,Schlammröhrenwürmer = Tubificidae). Die Gesamtgruppe der bestandesabfallverzehrendenTiere wird als Saprophage bezeichnet (z. B. auch Kotfresser und Aasfresser). (aus SCHERF1997).Da am Abbau von Bestandesabfall zahlreiche Pilz- und Bakterienarten beteiligt sind, derenBiomasse wesentlich besser auszunutzen ist als etwa zellulosereiches Pflanzenmaterial, sindmanche sog. Saprophage in Wirklichkeit Pilz- und Bakterienfresser oder nehmen zumindesttotes und lebendes Material auf (vgl. Abb. 1.4; Pfeil 12).Destruenten- und Saprophagennahrungskette werden in der angloamerikanischen Literatur alsDetritusnahrungskette zusammengefasst. Sie bauen auf Bestandsabfall auf, die Phytophagennahrungsketteauf lebendem Pflanzenmaterial.10
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2.2 Abiotische UmweltfaktorenAbiotische Faktoren = unbelebte Umweltfaktoren (natürliche sowie anthropogene).Die anthropogenen Umweltfaktoren umfassen solche, die es ohne den Menschen nicht gäbe(z. B. synthetisch hergestellte Stoffe, die sonst in der Natur nicht vorkommen). Zum zweitengehören hierher solche, die auch natürlicherweise vorkommen, aber vom Menschen in ihrerKonzentration so wesentlich erhöht bzw. verändert werden, dass Umweltschäden auftreten.Frage: Nennen Sie einige Beispiele für abiotische, anthropogen beeinflusste Umweltfaktoren!Abiotische Umweltfaktoren• Klimatische Umweltfaktoren: (Temperatur, Licht, Niederschläge, Feuchtigkeit, Wind, Luftdruck)• chemische Umweltfaktoren:• mechanische Umweltfaktoren:Fragen: • Welche Faktoren beeinflussen die Höhe oder Intensität der obengenannten klimatischenFaktoren?• Nennen Sie einige chemische und mechanische Umweltfaktoren.(vgl. Antwortblätter)2.3 Biotische Faktoren2.3.1 Ökologische InteraktionenSymbiose + + (Mutualismus = Symbiose i.e.S.; für beide Partnerobligatorische Symbiose)Konkurrenz - - Wettbewerb um begrenzte RessourcePrädation + - = Räubertum; Räuber-Beute-Beziehung; Räuber = Prädator;Parasitismus + - = SchmarotzertumNeutralismus 0 0a) Symbiose: Zeitweilige oder dauernde gegenseitige Beeinflussung artverschiedener Organismenzum wechselseitigen Nutzen (z. B. Versorgung mit Nährstoffen, Schutz vor Feinden, Förderungvon Fortpflanzung und Vermehrung). Symbiosen kommen zwischen verschiedenenOrganismengruppen vor:• Protisten/niedere Pflanzen und Pilzen: z. B. Flechten (Algen, Pilz);Flechten = Symbiose zwischen Pilzen u. autotrophem Partner, meist Grünalgen oder Cyanobakterien• Protisten/Bakterien und Pilzen: z. B. Flechten (Pilze, Cyanobakterien; siehe oben)• Höhere Pflanzen und Pilzen: z. B. Mykorrhiza (Kormophyt, Pilz; viele Bäume und Pilz)Mykorrhiza = Symbiose von Pflanzenwurzeln mit Pilzen => Pilzwurzel• Höhere Pflanzen und Protisten/Bakterien: z. B. Schmetterlingsblütler und Erlen mit Knöllchenbakterien(Kormophyt, Bakterien) => Luftstickstofffixierung• Höhere Pflanzen und Tieren: z. B. Blütenpflanzen und bestäubende Insekten• Tieren und Protisten/Bakterien: z. B. Säugetiere und Darmbakterien• Tieren und Protisten/Tieren: z. B. Wimpertierchen in Wiederkäuermagen, Ameisen undBlattläuseKormophyten: höhere Pflanzen; Sprosspflanzen oder Gefässpflanzen11
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BAUER 1982)(aus STEIGER 1994)12
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus SCHLEGEL 1985).(aus LÜTTGE et al. 1994).13
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgenb) Konkurrenz, Wettbewerb, competitionKonkurrenz ist der Wettbewerb von zwei oder mehr Organismen um eine begrenzteRessource. Zwei oder mehr Organismen nutzen entweder einen Umweltfaktor gemeinsamund beeinträchtigen sich deswegen gegenseitig in ihrer Existenz oder sie treten um seinenBesitz miteinander in Wettbewerb.Beispiele: Konkurrenz um Licht und Raum, um Nährstoffe und Feuchtigkeit (Wurzelkonkurrenzbei Pflanzen), um Beute, Wohnraum, Geschlechtspartner etc.Intraspezifische Konkurrenz: Konkurrenz zwischen Individuen derselben Art.Die Konkurrenz setzt bereits zwischen den Individuen gleicher Art ein. Der Zufall, der günstigereMikrostandort und kleine genetische Differenzen sind für das Aufkommen entscheidend.Die intraspezifische Konkurrenz ist deshalb sehr gross, weil die Individuen der gleichen Artmit den genau gleichen Waffen kämpfen. Sie nutzen die genau gleichen ökologischen Möglichkeitenaus; so liegen die Blätter und Wurzeln der Pflanzen im gleichen Raum.Interspezifische Konkurrenz: Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten.Zwischen verschiedenen Arten sind die Beziehungen sehr vielfältig. Oft nehmen zwei verschiedenePflanzenarten ganz verschiedene Mikrostandorte ein und beanspruchen auch fürdie Blätter oder Wurzeln verschiedene Raumschichten. In der gegenseitigen Beeinflussungkönnen sich zwei Arten ausschliessen, sie können miteinander in ein bestimmtes Gleichgewichtkommen, oder sie können sich gegenseitig ergänzen und fördern.So sind Dohlen, Stare und Hohltauben Höhlenbrüter, die ihre Höhlen nicht selber bauen können.Diese Arten treten in Konkurrenz zueinander um bereits bestehende Nistplätze.Objektive Erfassung der intra- und interspezifischen Konkurrenz bei Pflanzen ist nur durch denVergleich von Merkmalen beim Zusammenleben (Mischkultur) mit den gleichen Merkmalenbeim Alleinleben (Einzelkultur, Reinkultur) möglich (vgl. Abb. 63-65 und Abb. 389 auf den Folgeseiten).A AA AB B BBEinzelkultur Reinkultur Mischkultur Einzelkultur ReinkulturDas tatsächliche Vorkommen von Pflanzen in einem Biotop wird neben ihren ökologisch-physiologischenEigenschaften stark durch die Konkurrenz anderer Pflanzen beeinflusst (vgl. Zeigerwertenach LANDOLT 1977). Das ökologische Optimum unter Konkurrenzbedingungenkann stark vom physiologischen Optimum abweichen (vgl. Abb. 65 auf Folgeseite).Je nach dem betrachteten Merkmal können beim gleichen Zusammenleben verschiedeneTypen von Konkurrenz i.w.S. bzw. ökologische Interaktionen auftreten: - - , - 0 , - + oder sogar+ 0 und + + Beziehungen.Interaktionen können sich im Laufe der Zeit ändern!Konkurrenzausschlussprinzip oder Gause's Prinzip: Wenn zwei konkurrierende Arten koexistieren,dann tun sie das durch Nischendifferenzierung (=> ökologische Nische). Wenn einesolche Differenzierung nicht erfolgt, oder das Habitat sie nicht zulässt, dann wird eine Art dieandere verdrängen und ausschliessen. Ökologische Nische: Gesamtheit aller biotischer und abiotischerUmweltfaktoren, die für die Existenz einer bestimmten Art wichtig sind.14
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen15
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus ELLENBERG1986)(aus ELLENBERG1986)16
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenBeim Erwerb der Nahrung lassen sich verschiedene Typen unterscheiden.c) Prädation: Im Falle des Räubertums (Räuber-Beute-Beziehung bzw. Prädation) tötet einRäuber (Beutefänger, Prädator) seine Beute sofort und verzehrt im Regelfall im Lauf seinesLebens eine grosse Zahl von Beuteobjekten (Beispiel: Fuchs und Feldmaus oder Luchs undSchneehase; Lotka-Volterra-Gleichung vgl. <strong>Skript</strong> Vorlesung "Einführung aquatische Ökologie",Teil Prof. Zeyer).Räuber-Beute-Beziehungen bestehen zwischen vielen Tierarten, zwischen Tieren und Pflanzen,Pilzen bzw. Bakterien als Beute, ausnahmsweise auch zwischen Pilzen und Tieren alsBeute (Beispiel: Oomycet Zoophagus fängt Rotatorien). Einen Spezialfall stellt der Tierfangeiniger autotropher Pflanzen dar; diese tierfangenden ("carnivoren") Arten verbessern mit derBeute bei nährstoffarmen Substraten ihre N- und P-Versorgung. Beispiele: Sonnentau(Drosera), Venusfliegenfalle (Dionaea), Wasserschlauch (Utricularia).Als Weidegänger werden Tiere bezeichnet, die Teile von Pflanzen konsumieren und im Laufeihres Lebens oft zahlreiche Pflanzenindividuen ausbeuten, ohne dass diese im Regelfall tödlichenSchaden erleiden. Es gibt keine scharfen Grenzen zum Räubertum und zu den Schmarotzern.d) Parasitismus = Schmarotzertum: Beim Parasitismus (Schmarotzertum) lebt ein Parasit(Schmarotzer) an oder in anderen Organismen von deren Körpersubstanz, ohne den Wirtsofort oder überhaupt zu töten; meist werden im individuellen Leben des Parasiten nur wenigeWirte oder auch nur ein Wirt benötigt. Ein Wirt kann andererseits eine grosse Zahl vonParasiten beherbergen. Andere Parasiten wie Stechmücken sind nur temporär (kurzzeitig) undmeist nur zur Nahrungsaufnahme vom Wirt abhängig.Parasit-Wirt-Beziehungen gibt es zwischen den verschiedensten Organismentypen. Bakterien,Pilze, Pflanzen und Tiere haben Parasiten hervorgebracht. Auch Viren können als Parasitenangesehen werden.Pflanzliche Parasiten unterteilt man in Holoparasiten (Vollschmarotzer => kein Chlorophyll),die ganz auf den Wirt angewiesen sind, und Hemiparasiten (Halbschmarotzer => mit Chlorophyll),die nur einen Teil der Nährstoffe vom Wirt beziehen.Ektoparasiten besiedeln die Oberfläche des Wirts, Endoparasiten leben in dessen Innern.Wenn der Parasitenbefall eindeutig mit Krankheitsbildern verbunden ist, spricht man vonPathogenie.Als Parasitoide werden Parasiten bezeichnet, die ihren Wirt im Laufe ihrer Entwicklung abtöten;es ist dies eine Art Zwischenform zwischen Räuber und Parasit (daher Raubparasit;Beispiel: Schlupfwespen, deren Larven ihre Wirte am Ende der Larvalphase töten).(aus BICK 1998 sowie HEINRICH und HERGT 1998)17
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenFleischfressende PflanzenRundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia)Blatt mit FangtentakelnLangblättriger Sonnentau (Drosera longifolia)18
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenFleischfressende PflanzenGemeiner Wasserschlauch(Utricularia vulgaris)19
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2.4 Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora nach LANDOLT (1977)Die physiologischen Möglichkeiten und die Konkurrenz der anderen Lebewesen gestatten esden Pflanzen in der Natur nur unter ganz bestimmten Umweltbedingungen zu gedeihen. DurchKonkurrenz werden sie aus ihrem physiologischen Optimum ins ökologische Optimum verdrängt.Mit den ökologischen Zeigerwerten wird versucht, diese Bedingungen zu beschreiben.Die Zeigerwerte sagen aus, unter welchen Bedingungen eine Art im Feld anzutreffen ist (empirischerMittelwert des ökologischen Vorkommens). Die Zeigerwerte können allerdings im Allgemeinennicht gemessen werden, sondern beruhen auf Erfahrungen und auf den Beobachtungenvon Feldbotanikern. Der Vorteil der Zeigerwerte gegenüber wortmässigen Charakterisierungenberuht in der Kürze und in der numerischen Vergleichbarkeit. Ein Nachteil ist, dass Genauigkeitvorgetäuscht wird, die nicht immer gegeben ist. Auch lassen sich viele ökologische Besonderheitendurch die Zahlengebung nicht erfassen.Auch physiologisch mehr oder weniger einheitliche Arten verhalten sich in Bezug auf ihren Zeigerwertan verschiedenen Orten ihres Verbreitungsgebietes nicht immer ähnlich. Da in verschiedenenGebieten zum Teil andere Arten auftreten, ist die Konkurrenz nicht gleich. Oft sindauch die ökologischen Faktoren nicht unabhängig voneinander. Darum gelten die Zeigerwertenur für ein bestimmtes Gebiet (hier Schweiz) und können in anderen geographischen Gegendennicht mehr ohne weiteres angewendet werden. Auch ist zu berücksichtigen, dass viele Artenökologische Sippen ausbilden, die morphologisch oft schwierig unterscheidbar sind, aberverschiedene Zeigerwerte erhalten müssen. Auch an konkurrenzarmen Standorten (z. B. aufSchuttplätzen, an frischen Anrissstellen) können sich die Pflanze anders verhalten, als es ihrZeigerwert vermuten lässt.Es gibt Zeigerwerte für verschiedene Standortfaktoren:F Feuchtezahl: Die Feuchtezahl kennzeichnet die mittlere Feuchtigkeit des Bodens währendder Vegetationszeit. Niedere Zahlen zeigen geringe, hohe Zahlen grosse Bodenfeuchtigkeitan.F1 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf sehr trockenen Böden; auf nassen Böden nicht vorhanden,auf feuchten Böden nicht konkurrenzfähig. Ausgesprochene Trockenheitszeiger.F2 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf trockenen Böden; sehr trockene und nasse Böden meistmeidend; auf feuchten Böden im Allgemeinen nicht konkurrenzfähig. Zeiger mässigerTrockenheit.F3 Pflanzen auf mässig trockenen bis feuchten Böden, im Allgemeinen mit breiter ökologischerAmplitude; trockene und nasse Böden meist meidend. Zeiger mittlerer ("nicht extremer","frischer") Feuchtigkeitsverhältnisse.F4 Pflanzen mit Hauptverbreitung auf feuchten bis sehr feuchten Böden; gelegentlich auch aufnassen Böden vorkommend; trockene Böden meidend. Feuchtigkeitszeiger.F5 Pflanzen auf nassen, vom Wasser durchtränkten Böden; mittelfeuchte und trockene Bödenmeidend. Nässezeiger.Zur Kennzeichnung der vielfältigen Feuchtigkeitsverhältnisse werden zusätzliche Zeichen angewendet.Beispiel:w Pflanzen vorwiegend auf Böden mit wechselnder Feuchtigkeit; die Feuchtezahl zeigt diemittlere Bodenfeuchtigkeit an, das w bedeutet, dass der Boden nach Regenfällen bedeutendfeuchter, nach Trockenperioden trockener werden kann, als es der Feuchtezahl entspricht.20
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenR Reaktionszahl: Die Reaktionszahl ist charakteristisch für den Gehalt an freien H-Ionen imBoden. Niedere Reaktionszahlen zeigen saure, basenarme Böden an, hohe Zahlen entsprecheneinem hohen Basengehalt (neutrale bis basische Böden).R1 auf sehr sauren Böden (pH meist < als 4.5). Ausgesprochene Säurezeiger.R2 auf sauren Böden (pH meist zwischen 3.5 und 5.5), neutrale und basische Böden meidend.Säurezeiger.R3 meist auf schwach sauren Böden (pH zwischen 4.5 und 7.5), extrem saure Böden meidend.R4 auf schwach sauren bis schwach basischen Böden (pH zwischen 5.5 und 8), Böden mitpH unter 5 meidend. Basenzeiger.R5 auf neutralen bis kalkreichen basischen Böden, Böden mit pH unter 6.5 meidend. AusgesprocheneBasenzeiger (meist Kalkzeiger).N Nährstoffzahl: Die Nährstoffzahl kennzeichnet den Nährstoffgehalt (insbesondere Stickstoff)des Bodens. Niedere Zahlen zeigen wenig, hohe viel Nährstoffe an.N1 meist auf sehr nährstoffarmen Böden. Ausgesprochene Magerkeitszeiger.N2 meist auf nährstoffarmen Böden, seltener auf mittleren Böden. Magerkeitszeiger.N3 meidet sehr nährstoffarme und sehr nährstoffreiche Böden.N4 bevorzugt nährstoffreiche Böden. Nährstoffzeiger.N5 auf nährstoffreichen (meist Stickstoff), oft überdüngten Böden, meidet nährstoffärmere Böden.Überdüngungszeiger, in Gewässer Verschmutzungszeiger.H Humuszahl: Die Humuszahl ist charakteristisch für den Humusgehalt des Bodens amStandort der Pflanze. Hohe Humuszahlen deuten auf einen hohen Humusgehalt im Wurzelraumder Pflanze hin, niedere Zahlen auf geringe oder fehlende Humusbeimischung.H1 vorwiegend auf Rohböden (ohne Humusbedeckung). Rohbodenzeiger.H2 vorwiegend auf wenig entwickelten Böden mit geringem Humusgehalt; nicht auf Torf- undModerböden. Mineralbodenzeiger.H3 auf Böden mit mittlerem Humusgehalt. Nur selten auf Roh- oder Torfböden.H4 auf gut entwickelten Böden mit guter Humusschicht; kaum auf Rohböden. Humuszeiger.H5 vorwiegend in Humus oder Torf; kaum auf Mineralböden. Rohhumus- und Torfzeiger.D Dispersitätszahl (und Durchlüftungsmangelzahl): Die Dispersitätszahl kennzeichnetdie Teilchengrösse und die Durchlüftung (vor allem Sauerstoff) des Bodens am Standortder Pflanze. Niedere Zahlen charakterisieren Wachstumsunterlagen mit sehr groben Teilchen,hohe Zahlen solche mit sehr feinen Bodenpartikeln und/oder schlechter Sauerstoffversorgung.D1 vorwiegend in Felsspalten, auf Felsblöcken und auf Mauern. Felspflanzen.D2 vorwiegend auf mittlerem bis gröberem Schutt (ø > 2 mm). Geröll-, Kies- und Schuttpflanzen.D3 vorwiegend auf durchlässigen, skelettreichen oder sandigen Böden. Mittlerer ø 0.05-2 mm.D4 vorwiegend auf feinerdereichen, skelettarmen und mässig durchlüfteten Böden. Mittlerer ø0.002-0.05 mm.D5 vorwiegend auf feinerdereichen (tonigen oder torfigen), schlecht durchlüfteten Böden. Mittlererø < 0.002 mm. Tonzeiger, Torfzeiger oder Sauerstoffarmutzeiger.21
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenL Lichtzahl: Die Lichtzahl ist charakteristisch für die mittlere Beleuchtungsstärke, bei der diePflanzen während ihrer Vegetationszeit noch gut wachsen können. Niedere Zahlen bedeutenein geringes, hohe Zahlen ein grosses Lichtbedürfnis.L1 nur im starken Schatten (bis unter 3% relativer Beleuchtungsstärke, selten an Orten mitmehr als 30% rel. Beleuchtungsstärke). Ausgesprochene Schattenzeiger.L2 meist im Schatten oder Halbschatten, nur gelegentlich an helleren Stellen. Oft unter 10%relativer Beleuchtungsstärke. Schattenzeiger.L3 meist im Halbschatten, starke Beschattung meidend.L4 im Licht oder zeitweisen Halbschatten, aber stärkere Beschattung meidend. Lichtzeiger.L5 nur im Volllicht wachsend, erträgt keine Beschattung. Ausgesprochene Lichtzeiger.Bei Bäumen berücksichtigt der L-Wert die Lichtverhältnisse, unter denen die Jungpflanzen indie Oberschicht vorstossen können. Zum Blühen und Fruchten brauchen die Bäume meistvolles Licht.T Temperaturzahl: Die Temperaturzahl ist charakteristisch für die mittlere Temperatur, diedie Pflanze während der Vegetationszeit erhält. Sie richtet sich weitgehend nach der Höhenverbreitungder Pflanzen. Niedere Zahlen entsprechen einer Verbreitung in höheren Lagen,hohe Zahlen kennzeichnen Pflanzen in tiefen Lagen.T1 meist in der alpinen Stufe, nur an kühleren oder konkurrenzarmen Orten tiefer. TypischeHochgebirgspflanzen und arktische Pflanzen. In tiefen Lagen Kältezeiger.T2 meist in der subalpinen Stufe, nur an sonnigen, warmen Orten höher und an kühleren Ortentiefer. Gebirgspflanze und boreale Pflanze.T3 meist in der montanen Stufe, nur an warmen Orten höher und an kühleren Orten tiefer.T4 meist in der kollinen Stufe, nur an sonnigen, warmen Orten höher.T5 nur an den wärmsten Orten in der kollinen Stufe. Hauptverbreitung im südlichen Europa.K Kontinentalitätszahl: Die Kontinentalitätszahl kennzeichnet die Temperaturdifferenzen imTages- und Jahresverlauf und die Luftfeuchtigkeit. Niedere Zahlen zeigen geringe Temperaturunterschiedeund grosse Luftfeuchtigkeit, hohe Zahlen grosse Temperaturunterschiedeund oft hohe Lufttrockenheit an.K1 nur an Orten mit sehr milden Wintern und hoher Luftfeuchtigkeit (ozeanisches Klima).K2 nur an Orten mit milden Wintern oder langer Schneebedeckung (subozeanisch), Spätfrösteund grosse Temperaturextreme nicht ertragend.K3 in mittleren Lagen, ausserhalb sehr kontinentaler Gebiete. Im Gebiet fast überall vorkommend.K4 kommt auch an Orten mit kalten Wintern vor, bevorzugt grosse Sonneneinstrahlung imSommer, grosse Temperaturunterschiede, geringe Luftfeuchtigkeit (relativ kontinentales Klima).K5 nur an Orten mit kalten Wintern und sehr starker Sonneneinstrahlung, wind- und sonnenexponierteStellen. Kontinentales Klima.Für alle ökologischen Zeigerwerte gilt:x Pflanzen, die fast über das ganze mögliche Spektrum vorkommen, wurden mit x bezeichnet.W Wuchs- und Lebensform: Die Lebensformen im Sinne von RAUNKIAER umschreiben dieLage der Überdauerungsknospen während der ungünstigen Jahreszeit.h Hemikryptophyt. Pflanze, die mit Knospen auf oder direkt unter der Erdoberfläche überwintert.Weitere vgl. LANDOLT (1977)22
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BAUER E.W., 1982)23
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen24
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenÖkologische Zeigerwerte einiger ausgewählter Gräsernach LANDOLT (1977): Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora25
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenUntersuchung von Pflanzenbeständen; die VegetationsaufnahmeZur Erfassung von Pflanzenbeständen muss Folgendes beachtet werden;• Der Ort der Vegetationsaufnahme wird in der Regel gutachtlich ausgewählt. Er richtet sichnach den Autorenvorstellungen über die zu beschreibende Vegetation. Diese Vorstellungenmüssen klar dargelegt werden.• Die aufzunehmende Fläche muss eine Mindestgrösse aufweisen (Wälder 200-500 m 2 ; Wiesenund Weiden 5-25 m 2 ; offene Vegetation 25-100 m 2 ); die Form der Fläche spielt keineRolle.• Die Fläche muss homogen und einheitlich sein (z.B. gleiche Neigung, gleiche Bewirtschaftung,gleiche Lichtverhältnisse).• Es müssen alle Arten von Blütenpflanzen und Farnen und womöglich von Moosen berücksichtigtwerden; unbekannte Arten sind zu sammeln und später zu bestimmen, bzw. bestimmenzu lassen.• Jede Aufnahme ist mit genauen geografischen Angaben und einer Beschreibung der Standortverhältnisse(Neigung, Exposition, Höhe ü.M., womöglich Bodenprofil, Grossklima, pH,Humusgehalt, Feuchtigkeitsverhältnisse usw.) zu versehen.• Die Vegetation wird in Schichten aufgeteilt (1. und 2. Baumschicht, Strauchschicht, Krautschicht,Moosschicht) und der Deckungsgrad der einzelnen Schichten festgelegt (Prozentsatzder gesamten Fläche, die von einer Schicht mit lebenden Pflanzenteilen überdeckt ist;Projektion).• Innerhalb der Schicht wird eine vollständige Artenliste aufgenommen mit Angaben überHäufigkeit der einzelnen Arten. Die Reihenfolge der Arten spielt bei der Aufnahme keineRolle.• Bei Vegetationsaufnahmen können die Deckungswerte der einzelnen Pflanzen in Prozentgenauigkeitgeschätzt werden. In der Regel erfolgt die Bewertung der Arten nach einerDeckungswertskala von BRAUN-BLANQUET (1964, aus WILLMANNS 1989, verändert) gemässfolgender Skala (kombinierte Zahl für Abundanz und Dominanz = Individuenzahl undDeckungsgrad).rDeckung unter 1 %; ganz vereinzelt; 1-2 Individuen pro Fläche, oft mit verminderter Vitalität,kaum fruchtend, auch ausserhalb der Fläche nur sporadisch+ Deckung unter 1 % (wenig Fläche deckend); nur wenige Individuen (z.B. bis 10)1 Deckung zwischen 1 bis 5 % oder Individuen zahlreich (z.B. mehr als 10 Individuen)2 m Deckung unter 5 %; Individuenzahl jedoch sehr zahlreich (z.B. mehr als 50 Individuen)2 - Deckung zwischen 5 und 15 %; Individuenzahl beliebig2 + Deckung zwischen 15 und 25 %; Individuenzahl beliebig3 Deckung zwischen 25 und 50 %; Individuenzahl beliebig4 Deckung zwischen 50 und 75 %; Individuenzahl beliebig5 Deckung zwischen 75 und 100 %; Individuenzahl beliebig* Randart, zusätzliche Art ausserhalb der Aufnahmefläche26
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenDauerfläche 2Allgemeine AngabenGemeinde / OrtAmden / SchafbergDatum: 22.7.2001Koordinaten 734 910 / 223 600Lage im GeländeMulde, Lägerstelle neben altem WegHöhe über Meer1795 mExpositionSSENeigung 10 %Flächengrösse2 m x 2 mVegetationsaufnahmenArt Deckung in % Deckung nach %Rumex alpinus 80 5Aconitum compactum 20 2Chaerophyllum cicutaria 15 2Stellaria nemorum 10 2Myosotis alpestris 8 2Poa alpina 4 1Rumex arifolius 2 1Deschampsia caespitosa 0.8 +Alchemilla xanthochlora 0.5 +Trifolium pratense 0.5 +Ranunculus friesianus 0.4 +Ranunculus montanus 0.2 +Urtica dioeca 0.2 +Viola biflora1 Expl.rArabis alpina Randart *Chenopodium bonus-henricus Randart *27
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenMittlere Zeigerwerte einer VegetationsaufnahmeDie Zeigerwerte einzelner Pflanzen sagen nur bedingt etwas aus, weil die einzelnen Arten jenach Konkurrenzbedingungen gelegentlich auch unter anderen Bedingungen gedeihen können,als es ihren Zeigerwertzahlen entsprechen würde. Dagegen lassen sich die Verhältnissesehr gut charakterisieren, wenn wir alle Arten einer Lebensgemeinschaft berücksichtigen. Dabeiist es einleuchtend, dass Pflanzen, die am Standort zahlreich oder mit grosser Deckungauftreten, ein höheres Gewicht erhalten müssen als seltene Arten.Berechnung: Am einfachsten ist es, Arten mit einem Deckungswert von "+" einmal, solche miteinem Deckungswert von "1" zweimal, solche mit "2" dreimal, ... solche mit "5" sechsmal zu gewichten.Der Mittelwert ist die Summe der gewichteten Zeigerwerte geteilt durch die Summeder Gewichtungsfaktoren. Er kann nun mit den Mittelwerten anderer Vegetationsaufnahmenverglichen und somit können auch Standortsunterschiede herausgearbeitet werden.Der Durchschnittswert für w (wechselfeucht) wird in einem Bruch angegeben. Wenn die wechselfeuchtenArten weniger als 1/8 stark vertreten sind, wird der w-Wert weggelassen.Oft ist es sinnvoll, mittlere Zeigerwerte getrennt für die einzelnen Schichten der Vegetation zuberechnen. Die Schicht sollte aber mindestens eine Deckung von 10% aufweisen.Bei der Auswertung der mittleren Zeigerwerte muss berücksichtigt werden:• dass die Mittel immer weniger von der Mitte abweichen, als es den Standortseigenschaftenentsprechen würde, da sehr viele Pflanzen mit mittleren Zeigereigenschaften auch unterextremeren Verhältnissen vorkommen. So bedeutet etwa eine 3.5 als F-, R-, N- oder H-Zahl bereits einen recht feuchten, basenreichen, nährstoffreichen bzw. humusreichen Boden,eine 2.5 einen entsprechend recht trockenen, sauren, mageren bzw. humusarmenBoden.• dass eine Art nur gerade über die Standortfaktoren jener Schichten etwas aussagt, in dersie wächst. Moose sind allgemein nur aussagekräftig für eine Schicht von höchstens 5 cmdirekt über und unter der Bodenoberfläche. Auf der anderen Seite können Bäume dieStandortsqualität bis zu mehreren Metern oberhalb und unterhalb der Bodenoberfläche anzeigen.Es kommt durchaus vor, dass etwa Moose und oberflächlich wurzelnde Zwergsträuchereinen sauren mageren Boden anzeigen, während die tiefer wurzelnden Hochstaudenund Sträucher Basen- und Nährstoffreichtum erkennen lassen.28
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen29
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2.5 Sukzession und Mosaikzyklus-KonzeptUnter Sukzession versteht man ganz allgemein eine zeitliche Aufeinanderfolge verschiedenerOrganismengemeinschaften an der gleichen Stelle. Man kann zwei Vorgänge unterscheiden:1.Bei der primären Sukzession handelt es sich um die erstmalige Besiedlung von neu entstandenenFlächen; z. B. die Besiedlung von einer durch vulkanische Prozesse neu entstandenenoder völlig verwüsteten Insel oder von Flächen, die durch den Rückzug eines Gletscherseisfrei geworden sind. Von einer Sukzession sollte man aber nur sprechen, wenn derVorgang unter mehr oder weniger gleichbleibenden Klimafaktoren abläuft. Ein wiederholterWechsel in der Pflanzen- und Tierbesiedlung eines Ökosystems aufgrund von Klimaveränderungenist als Reaktion auf Störungen des Gesamtbeziehungsgefüges aufzufassen undstellt keine Sukzession dar. Eine typische primäre Sukzession spielt sich dann ab, wennman ein neu geschaffenes stehendes Gewässer ohne absichtliches Einbringen von Pflanzenund Tieren völlig sich selbst überlässt.2.Als sekundäre Sukzession werden Wiederherstellungsprozesse bezeichnet. Ausgangspunktdieses Prozesses können alle durch Wettererscheinungen, Feuer, Vegetationszerstörungdurch Tierfrass, Alterstod von Bäumen oder anderen ökosystemprägenden Gliedernder Biozönose, Überschwemmungen, Lawinen oder Muren (d. h. Schutt- oder Schlammströmeim Hochgebirge) hervorgerufenen Störfälle sein. Vom Menschen ausgelöste Störungenwie Kahlschlag oder Abbrennen von Flächen gehören ebenfalls in diese Liste. SekundäreSukzessionen laufen auch dann ab, wenn vom Menschen genutzte oder bewirtschafteteFlächen sich selbst überlassen werden; Beispiele: nicht mehr genutztes Industriegelände,nicht mehr von Haustieren beweidete Flächen, aus der Nutzung genommene Ackerflächen.Das Resultat solcher Wiederbesiedlungsvorgänge kann man in Wüstungen beobachten, d. h.in aufgelassenen Siedlungsflächen des Mittelalters oder der frühen Neuzeit, die heute völlig zuWald geworden sind. Sekundäre Sukzessionen laufen auch auf den Brachflächen des traditionellenWanderfeldbaus der Tropen ab (Wald-Feld-Wechselwirtschaft); hier wird der Sukzessionsprozessjedoch jeweils nach einer gewissen Zeit gestoppt und der entstandene junge Sekundärwalderneut gerodet, um Kulturen anzulegen. Der Sukzessionsprozess dient hier derRegeneration der Bodenfruchtbarkeit. Auch im tropischen Regenwald gibt es Beispiele eineserfolgreich ablaufenden Wiederherstellungsprozesses. So sind viele verlassene Mayastädteund ihr ursprünglich landwirtschaftlich genutztes Umland in Mittelamerika im Verlauf von etwa500 Jahren wieder von dichtem Wald überwuchert.Zu den Sukzessionen rechnet man auch die Besiedlungsabfolge von Organismen beimAbbau von Bestandsabfällen wie Kot oder Kadaver (Aas); hierbei handelt es sich aber in derRegel um sehr kleinräumige Ereignisse und im Gegensatz zu den übrigen Sukzessionsprozessenlöst sich dieser Ökosystemteil nach Verbrauch der Nahrungsbasis auf. Die Mitgliederder Gemeinschaft müssen an anderer Stelle neu Fuss fassen. Sukzessionen spielen sich alljährlichvon Frühjahr bis Sommer im Pelagial (Freiwasserzone) von Seen der gemässigtenKlimazone ab; hier kommt es zu typischen Abfolgen verschiedener Phyto- und Zooplanktonarten.Den äusseren Anstoss zu dieser Sukzession geben im Frühjahr zunehmende Lichtintensitätund steigende Temperatur bei einem zunächst hohen Angebot von anorganischen Pflanzennährstoffen.Die Sukzession im Plankton findet im Herbst ihr Ende und im nächsten Jahrwiederholt sich der Prozess in ähnlicher Weise.30
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenIn vielen Ökosystemen kann man beobachten, dass sekundäre Sukzessionen als Folge desAbsterbens von einzelnen Komponenten der Lebensgemeinschaft durch Alterstod oder durchStörfälle auf verschiedenen kleineren oder grösseren Flächen und zu unterschiedlichen Zeitenablaufen. Bekannt ist das insbesonders von Wäldern, wo entsprechend ein mosaikartiges Nebeneinandervon Beständen verschiedenen Alters besteht, die jeweils einem bestimmten Sukzessionsstadiumentsprechen (vgl. Abb. 139 auf Folgeseite). Jede dieser zeitversetzt («desynchron»)ablaufenden Sukzessionen machen einen Zyklus durch, dessen Endzustand wiederdem Ausgangszustand vor dem sukzessionsauslösenden Ereignis entspricht. Solche Ökosystemesind folglich aus einem Mosaik verschiedener Teilsysteme aufgebaut, die sich jeweils ineinem bestimmten Entwicklungszustand des Sukzessionszyklus befinden («Mosaik-Zyklus-Konzept der Ökosysteme», siehe z. B. REMMERT 1992). So enthält ein Waldökosystem beispielsweisenebeneinander so unterschiedliche Kompartimente wie offene Lichtungen, Gebüschformationenund Hochwald, die aber alle dem Gesamtsystem zugehörig sind. Je nachWaldtyp unterscheiden sich die Vorgänge etwas. In baumartenreichen tropischen Regenwäldernmit unterschiedlichem Alter der einzelnen Bäume und verschiedener Lebenserwartungsterben – abgesehen einmal von Wirbelsturmkatastrophen – in der Regel einzelne Bäume abund schlagen beim Umstürzen eine langgestreckte Lücke in den Bestand; in dieser läuft danneine zur Verjüngung des Teilbestandes führende Sukzession ab. Hingegen sterben in artenarmenWäldern vom Typ borealer (kalt-gemässigter) Nadelwald («Taiga») eher grössere Gruppengleichalter Bäume etwa zur gleichen Zeit, so dass die Sukzessionsfläche relativ grosswird. Entsprechend sind hier die einzelnen Mosaikteile des Gesamtsystems besonders deutlicherkennbar.Den Entwicklungszyklus in den einzelnen Teilflächen eines mosaikartig aufgebauten mitteleuropäischenUrwalds vom Typ sommergrüner Laubwald kann man grob so beschreiben (vgl.Abb. 139 und 144 auf Folgeseiten):(1) Jugendphase mit hohem Anteil niederwüchsiger Kräuter, Sträucher und Baumsämlingen,hohe Netto-Primärproduktion, reich an Pflanzen- und Tierarten, hohes Nahrungsangebotfür phytophage Grosssäugetiere;(2) Phase des sich schliessenden Kronendachs, zunehmende Beschattung des Bodens,Minderung der Krautschicht;(3) Hochwaldphase (Optimalphase, vgl. Abb. 2) mit der typischen Schichtung in Strata (Kronen-,Baum- und Stammschicht, Strauchschicht, Krautschicht, Streuschicht und Bodenschicht),geschlossenes Kronendach, im Sommer sehr geringe Lichtintensität am Boden,vergleichsweise geringer Bodenbewuchs mit hohem Anteil an Frühjahrsblühern, Netto-Primärproduktiongeringer als bei (1);(4) Altersphase mit Übergang zur Zerfallsphase, in der Bäume absterben und beim NiederstürzenLücken in den Bestand schlagen; die Lichtintensität am Boden nimmt zu, dieVerjüngung wird eingeleitet und der Sukzessionszyklus beginnt von vorn. (aus BICK 1998)31
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen32
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2.6 Produktion und StabilitätSchematische Darstellung der vier Grundtypenökologischer Stabilität in Abhängigkeit vom dynamischenVerhalten des betrachteten Merkmalsund vom Fehlen oder Vorhandensein einesFremdfaktors (Störfaktor)(aus GIGON 1984)33
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenBegriffe zur Stabilität von Ökosystemen (aus BICK 1998)Im Zusammenhang mit der Reaktion von Ökosystemen auf sich wandelnde Ausseneinflüsse,insbesondere auch auf menschliche Eingriffe oder Stoffeinträge werden folgende Begriffe benutzt:Stabilität bezeichnet die Fähigkeit eines Ökosystems, Störungen zu widerstehen oder nacheiner Störung wieder zum ursprünglichen Organismenbestand, Energie- und Stoffhaushalt zurückzufinden.Der Gegensatz ist Labilität; ein labiles System ist nicht in der Lage, Störungenzu ertragen oder auszugleichen (instabiles System).Elastizität («resilience») ist ein Mass für die Fähigkeit eines Ökosystems, Störungen zu ertragenund zu überleben. Je elastischer ein Ökosystem ist, desto stärker kann die störungsbedingteAbweichung von den Normalbedingungen sein, ehe eine Umwandlung zu einem anderenÖkosystem erfolgt, d. h. das bestehende System zerstört ist. Als empfindlich gelten Ökosysteme,die schon bei geringen Störungen ihre Identität verlieren, also in ein anderes Ökosystemmit einem anderen ökologischen Gleichgewicht übergehen; solche Ökosysteme habeneine sehr geringe Elastizität (fragile Ökosysteme).Störung wird definiert als Abweichung von gegebenen Normgrössen der ökologischen Faktoreneines Ökosystems, die zu dauerhaften oder vorübergehenden Veränderungen führt. Dabeikann es sich um einzelne Faktoren oder um Faktorenkomplexe handeln. Abweichungen vonder Norm entstehen im übrigen auch aufgrund von menschlichen Eingriffen in ein Ökosystem,z. B. Mahd, Holzeinschlag, Entwässerung.Geringe Abweichungen von der Norm, die Produktion und Leistungsfähigkeit eines Ökosystemseinschränken, werden vielfach als Stress bezeichnet. Stressfaktoren können z. B. Temperatur,Licht, Wasser oder Nährstoffe sein. Starker Stress bewirkt eine Veränderung desSystems, bedeutet also eine Störung.Störungen können natürlichen oder anthropogenen Ursprungs sein. Jede vom Menschen ausgehendeStörung wird entgegen weitergehenden Definitionen hier als Belastung bezeichnet.Dieser Begriff spielt vor allem im Umweltschutz eine Rolle. Eine Belastung in diesem Sinn stellenmechanische Eingriffe (Bachbegradigung, Flussregulierung, Strassenbau u. a.) und Stoffeinträge(Abwasser, Abfall, luftverunreinigende Stoffe) oder Abwärmeeintrag (Kühlwasser) dar.Dabei ist zwischen direkten Schadeffekten zu trennen, die einen Organismus unmittelbar treffen,und indirekten Wirkungen, die z. B. dadurch entstehen, dass eine Pflanzenart geschädigtund damit die Lebensgrundlage einer nahrungsmässig davon abhängigen Tierart vernichtetwird.Unter Belastbarkeit eines Ökosystems ist diejenige Intensität eines Störfaktors oder einesStörfaktorenkomplexes zu verstehen, die gerade noch ohne bleibende Schadwirkung kompensiertwerden kann. Belastbar sind nur stabile Systeme. Die Höhe der Belastbarkeit hängt vonder Elastizität des Ökosystems ab.Die Begriffe Belastung und Belastbarkeit spielen im praktischen Umweltschutz beim Ökosystemschutzeine grosse Rolle. In Kenntnis der Belastbarkeit eines bestimmten Ökosystemskann man Grenzwerte der Belastung zum Schutz des betreffenden Ökosystems festlegen. Inder Praxis erschwert jedoch häufig das gleichzeitige Einwirken mehrerer Störfaktoren die Festlegungvon Grenzwerten, da Schadstoffkombinationen ebenso wie ein Zusammentreffen vonSchadstoffeinträgen und menschlichen Eingriffen vielfach andere, oft belastendere Wirkungenzeigen als einzelne Schadstoffe oder Eingriffe.34
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenBiomasseNPPNPP35
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenAbb. 2: Schema der Grössenordnung der Biomasse in t Tr.S./ha (grosse Ziffern und kleine in Klammern)und deren Fluxe in t Tr.S./ha Jr. (kleine Ziffern) in einem 117-jährigen, mitteleuropäischen Laubmischwaldmit Zuwachs 7 t Tr.S./ha Jr. Aus GIGON A., <strong>Skript</strong> "Allgemeine Ökologie" nach Angaben von DUVIGNE-AUD (1974).36
2 Das Ökosystem Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen37
2 Das Ökosystem / 3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen2.7 Zusammenfassung terrestrische Ökosysteme, allgemeiner TeilDie auf dem festen Land zu findenden Ökosysteme werden als terrestrische Ökosysteme zusammengefasst.Für die Ausprägung der verschiedenen Ökosystemtypen sind die Klimafaktoren, also Temperaturund Niederschläge von entscheidender Bedeutung. Weitere wesentliche Wirkungen gehenvon den Bodenverhältnissen, insbesondere von der geologischen Ausgangssituation undvon der Geländebeschaffenheit aus. Im Gegensatz zu den aquatischen Ökosystemen ist Wasserin Landökosystemen oft ein limitierender Faktor. Landökosysteme haben infolge von Luftbewegungeneinen raschen Austausch der Gase O 2 , CO 2 und N 2 , so dass Mangelsituationenoder Anreicherungen im Gegensatz zu Gewässern fehlen; eine Ausnahme stellt allerdings derBoden dar, wo der Austausch mit der Atmosphäre eingeschränkt ist und O 2 -Mangel ebensowie CO 2 -Anreicherung vorkommen. Der Boden ist für die Pflanze das Wurzelsubstrat, in demdie mechanische Verankerung erfolgt und aus dem Wasser und Pflanzennährstoffe wie Ammonium,Nitrat oder Phosphat entnommen werden. Im Boden laufen unter Beteiligung von Bodenorganismenaus verschiedensten systematischen und ökologischen Gruppen wesentlicheUmsetzungsprozesse ab; das hierfür verantwortliche Destruenten-Saprophagensystem unterscheidetsich nach mitwirkenden Gruppen und Gesamtleistung in den einzelnen Ökosystemtypenebenso wie Aufbau und Leistung des Phytophagensystems (aus BICK 1998). Entscheidendfür die Ausprägung der Ökosysteme sind natürlich auch die Primärproduzenten, ökologischeInteraktionen ausserhalb der Nahrungsketten sowie der Mensch. In den folgenden Kapitelnwerde ich auf einige Charakteristikas einzelner ausgewählter Ökosysteme eingehen.3 Ökosystem Wald3.1 Sommergrüne LaubwälderEin gemässigtes Klima mit einer deutlichen aber nicht zu langen kalten Jahreszeit und ausreichendenNiederschlägen während der Vegetationszeit stellt die Voraussetzung für die Entwicklungsommergrüner Laubwälder dar. Der winterliche Blattabwurf ist als Anpassung andie Kälteperiode zu sehen. Rentabel im Sinne der Gesamtjahresenergiebilanz der Pflanze istder Abwurf der dünnen, sommergrünen und gegen Frost nicht widerstandsfähigen Blätter sowieder notwendige winterliche Schutz der Knospen aber nur, wenn eine ausreichend warme,mindestens vier Monate währende sommerliche Photosynthesephase mit positiver Bilanz gegebenist. Sind die Sommer zu kurz oder zu kühl, so gewinnen Nadelhölzer die Oberhand (borealeNadelwälder).Reicht das Jahresniederschlagsvolumen für die Wasserversorgung der Bäume nicht aus, kannes zur Ausbildung von Grasland kommen. Niederschlagsarme, warme Sommer mit niederschlagsreichen,milden Wintern fördert immergrüne Hartlaubgehölze, die z. B. im Mittelmeergebietdie sommergrünen Laubwälder ersetzen.Der sommergrüne Laubwald ist in seinem über die gemässigten Klimazonen Europas, Ostasiens,Nordamerikas sowie Südchiles und Neuseelands sich erstreckenden Verbreitungsgebieteinheitlich als vielschichtige Pflanzengesellschaft aufgebaut. Im Artenbestand bestehenjedoch zwischen den Laubwäldern der einzelnen Erdteile deutliche Unterschiede, die biogeographischeUrsachen haben und auf der Nordhemisphäre insbesondere auf die unterschiedlichenAuswirkungen der Eiszeit zurückgehen. (aus BICK 1998)38
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen3.2 Mitteleuropäische Waldvegetation in der SchweizDas Reich der BucheDie waldbildenden Baumarten besitzen wie alle Pflanzen spezifische Standortansprüche undÜberlebensstrategien (vgl. Abb. 1 auf Folgeseite). Anpassungsfähige, auf unterschiedlichenStandorten gedeihende Arten müssten demnach im Konkurrenzkampf, einem gut diversifiziertenHandelsunternehmen ähnlich, zur Überlegenheit gelangen und über weite Strecken dasWaldbild dominieren. Tatsächlich ist in Mitteleuropa weiträumig die Rotbuche (Fagus sylvatica)die prägende Art des sommergrünen Laubwaldes, da sie «auf allen nicht zu nassen,nicht zu trockenen, nicht übermässig nährstoffreichen und nicht zu kalten Standorten den anderenBaumarten» überlegen ist (Ellenberg 1978, S. 111).Die Rotbuche bildet unter mittleren Standortbedingungen reine, gegenüber anderen Baumartenunduldsame Hallenwälder. Keine andere Baumart in Mitteleuropa ist im gemässigten,ozeanisch getönten Klima fähig, derart ausgedehnte Reinbestände zu bilden, so dass einBuntspecht im unberührten Naturwald zwischen Kopenhagen und Landquart praktisch durcheinen geschlossenen Buchenwald fliegen könnte.Wo die ökologischen Ansprüche der Rotbuche nicht erfüllt werden, entwickeln sich an Stelleder Buchenwälder andere Waldtypen.In wärmeren, kollinen Grenzlagen der Buche mischen sich zunehmend Eichen-Hagebuchenwäldermit wechselnden Kombinationen von Stiel-Eiche, Trauben-Eiche und Hagebuche dazu(Quercus robur, Q. petraea und Carpinus betulus). In südexponierten warmtrockenen Lagenwächst auch Flaumeichenwald mit Flaum-Eiche (Quercus pubescens) als typischer Baumart.Die auch das Schweizer Mittelland kreuzenden Grenzlinien sind recht fliessend und durchmenschliche Eingriffe, zum Beispiel Mittelwaldwirtschaft, leicht verschiebbar.In den Flussauen finden sich Auenwälder, die entweder als Weichholz- oder als Hartholzaueausgebildet sind und entsprechend Weiden, Pappeln, Erlen bzw. Bergulme, Esche, Stieleicheals vorherrschende Bäume besitzen (Salix sp., Populus sp., Alnus sp., Ulmus glabra, Fraxinusexcselsior, Quercus robur). (aus STEIGER 1994). (vgl. Fig. 8 und 9).Im Banne der NadelbäumeIm Montanbereich mit zunehmend kürzerer Vegetationsperiode lässt die in der Submontanstufenoch ungebrochene Konkurrenzkraft der Buche nach. Tanne, Fichte und stellenweise Bergahorn(Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanus) bilden mit der Buche zwischen 900 -1300 m Höhe ausgedehnte Mischbestände der Tannen-Buchenwaldstufe. Die Buche kommtauf der Alpennordseite an günstigen Stellen lokal bis zu 1500 m Höhe waldbildend vor und erreichtim südlichen Tessin auf über 1600 m Höhe gar geschlossen die Waldgrenze.Neben diesen Ausnahmefällen ist aber die ganze obere Montan- und Subalpinstufe zwischen1300 - 2300 m natürlicherweise von Nadelwäldern besiedelt. Fichtenwälder nehmen darinden grössten Platz ein. Die durch Anpflanzungen, überhöhte Wildbestände und Beweidungstark geförderte, relativ verbissfeste Fichte ist heute mit einem Anteil von 40% der Waldbäume,gemessen am Holzvorrat gar der Hälfte, der häufigste Baum der Schweiz.Am luftfeuchten Alpennordrand und in den Alpen, besonders im Wallis, bildet die Weisstanneim Montanbereich lokal auch grössere Reinbestände, zum Beispiel in den Tälern der Morgeund Liène VS. (aus STEIGER 1994).39
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenAbb. 1: Standortansprüche verschiedener Baumarten (aus SCHMIDER et al. 1993).Das Beispiel der Föhre beweist, dass ein extrem breites Standortspotential, das in der Submontanstufebeinahe den gesamten waldfähigen Bereich abdeckt und von keiner andern Art erreicht wird, nichtzwangsläufig zur Vorherrschaft führt. Die Föhre erreicht ihre besten Wuchsleistungen auf denselben tiefgründigen,nährstoffreichen Böden wie die Buche oder Tanne. Hier fehlt die Föhre aber natürlicherweisevollständig, als lichtbedürftige Pionierart verdrängt durch die starkwüchsige, stark schattende und im Jugendstadiumauch schattentolerante Buche oder Tanne. Die Föhre hat also gewissermassen ein zu breitesWuchsspektrum, um in ihrem Wuchsoptimum zur Vorherrschaft zu gelangen, insbesondere fehlt ihrdie im Konkurrenzkampf der Waldbäume so wichtige Eigenschaft der Schattenverträglichkeit.40
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus IMBODEN 1976)41
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen3.3 Höhenstufen der Vegetation der SchweizIn Ländern wie zum Beispiel Luxemburg, Estland, weiten Teilen Russlands und der Ukrainefehlt eine höhenbedingte Vegetationsstufung weitgehend. In der Schweiz mit stark ausgeprägtemRelief und fehlenden Tiefländern sind höhenbedingte Wechsel der Vegetation oft auf kürzesterDistanz weitverbreitet. Auf wenigen Kilometern wiederholt sich ein Wechsel der Klimazonenund Vegetationsbilder, der im Extremfall – wie im Bergell und Wallis – dem Unterschiedzwischen der Lombardei und dem Ural oder der Provence und Nordskandinavien entspricht.Die Höhenstufen kann man als vertikal, oft auf wenige hundert Höhenmeter komprimierte Vegetationsgürtelansehen, welche sich in der Fläche über viele hundert Kilometer erstrecken.Innerhalb der Höhenstufen oder Vegetationsgürtel bleibt die Vegetation oft erstaunlich konstant.Die Wechsel zu tiefer- oder höherliegenden Stufen sind manchmal kontinuierlich, wie diezunehmende Beimischung von Nadelbäumen im Übergang vom Buchen- zum Tannen-Buchenwald.Nicht selten finden sich aber auch scharfe, durch das Relief häufig verstärkte Grenzen,so beispielsweise zwischen Flaumeichen- und Buchenwald oder zwischen Tannen- undLärchenwald im Sopraceneri. (aus STEIGER 1994).PlanarstufeDie Planarstufe der Tiefebene unter 200 m Meereshöhe fehlt in der Schweiz ganz.Kolline Stufe (Hügelstufe, Eichenwald-Stufe)Die kolline Stufe zwischen 200 - 600 m wird durch Eichenwald gekennzeichnet. In den Ebenenist dieser häufig als Eichen-Hagebuchenwald ausgebildet, an warmen Felshängen wächstFlaumeichenwald, in der Süd- und Ostschweiz auch Traubeneichenwald.Weiter wärmeliebende und damit typische Baumarten dieser Stufe sind Kirschbaum, Winterlindeund Feldahorn (Prunus avium, Tilia cordata, Acer campestre).Nadelwälder sind entweder auf wenige Spezialstandorte beschränkt oder angepflanzt. Rottanne(Picea abies oder P. excelsa) oder Weisstanne (Abies alba) kommen in dieser Stufe natürlicherweisekaum vor.Heute ist die kolline Stufe viel markanter durch den Rebbau als durch Eichenwälder gekennzeichnet(=> die kolline Stufe entspricht etwa der Weinbaustufe). Viele gute Reblagen der Alpennordseitestocken auf dem Areal früherer Eichenwälder, die oft nur noch in Relikten vorhandensind, so in der Lavaux oder am Bielersee. Die Jahrestemperaturmittel liegen über 9Grad, die Schneebedeckung ist kurz und fehlt in manchen Jahren ganz. Die Rebengrenze unddie Grenze des Edelobstanbaus, wie auch der natürliche Übergang vom Eichen- zum Buchenwald,markieren die Grenze zur Submontanstufe auf 400 - 600 m Meereshöhe oft scharf.Die Vegetationszeit dauert mindestens 250 Tage.SubmontanstufeDie Submontanstufe zwischen 400 - 800 m ist das unangefochtene Reich der Buche. Im Mittellandbildet sie eine geschlossene, nur in Becken und Hanglagen von der zerstückelten Kollinstufeunterbrochene Fläche. Intensiver Ackerbau und starke Besiedlung haben den Wald42
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgenstark zurückgedrängt (=> die submontane Stufe entspricht etwa der Obst-Ackerbaustufe).Die künstliche Umwandlung in standortfremde Fichtenforste ist in manchen Gegenden weitverbreitet.In der insubrischen Submontanstufe herrscht zumeist ebenfalls die Buche vor. DieTemperaturmittel liegen zwischen 7 - 9 Grad, die Schneebedeckung beträgt normalerweise einbis zwei Monate. Die Vegetationszeit dauert 220 - 250 Tage.Montanstufe (Bergstufe)Die Montanstufe nimmt besonders im Jura und am Alpenrand ausgedehnte Flächen zwischen800 bis 1500 m ein. In kühlen Schattenlagen kann sie schon bei 700 m, selten sogar bei 500m beginnen, in den Zentralalpen bis 1800 m ansteigen. Die sehr breite Montanzone muss zurBezeichnung der verschiedenen darin enthaltenen Vegetationsgürtel stärker differenziert werden,wobei sich die angegebenen Höhengrenzen lokal gelegentlich um mehrere hundert Meterverschieben können:• Unterer Montanbereich 800 - 1000 mDie Buche herrscht vor, Tanne und Bergahorn sind natürlicherweise eingestreut. In dentrockenen Tälern der Inneralpen wächst örtlich ausgedehnter Föhrenwald (mit Pinus sylvestris,kontinentale Bergstufe). Ackerbau und Wiesland sind weitverbreitet.• Mittlerer Montanbereich 1000 -1400 mDer Tannen-Buchenwald mit einer starken Durchdringung von Buche, Tanne, Fichte, Bergahorn,Bergulme und der bei 1200 m ausklingenden Esche bildet das natürliche Waldkleid,das infolge schwächerer Landwirtschaftsnutzung mit Milchwirtschaft vielerorts noch ingrösseren zusammenhängenden Flächen vorhanden ist. Der natürliche Laubholzanteil istin dieser Höhenstufe auf der Alpennordseite vielerorts zugunsten einer einseitigen Fichtenbestockungverschwunden. Im Wallis und im Tessin wachsen örtlich noch naturnahe, reineTannenwälder.• Oberer Montanbereich 1400 - 1800 mLaubwald ist in diesem Bereich nur noch in Ausnahmefällen, meist auf schneereichen, nadelbaumfeindlichenRutschhängen und in Lawinenbahnen vorhanden. Die Fichte herrschtnatürlicherweise oft vor und bildet in den Randalpen häufig die Waldgrenze. An vielen Stellenwurde der natürlich vorhandene Tannenanteil zugunsten der Fichte vernichtet. In denZentralalpen mischt sich, besonders auf Pionierstandorten, die Lärche bei. In den Randalpenwerden die Wälder von Sommerweiden (Alpen) unterbrochen oder abgelöst, in dentrockeneren Zentralalpen wird oft ausgedehntes Wiesland bewirtschaftet. Die Temperaturmittelbetragen im Montanbereich 3 - 8 Grad, die durchschnittliche Schneebedeckung 4 -7 Monate.Subalpinstufe (Rottannen-Stufe)Die Subalpinstufe beginnt an der theoretischen Obergrenze der Laubbäume auf 1600 - 1700 mund reicht unter zunehmender Ungunst des Klimas für den Waldwuchs bis zur Waldgrenze aufmaximal 2370 m Höhe. Besonders in kühlen, niederschlagsreichen Lagen kann die Subalpinstufeaber schon bei 1400 m beginnen. Höher ansteigende Einzelbäume im Zwergstrauchgürtel(Baumgrenze) werden bereits zur Alpinstufe gezählt.43
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenIn der Subalpinstufe gedeiht in vielen Regionen die im subalpinen Fichtenwald schmalkronigwerdende Fichte alleinherrschend bis zur Waldgrenze auf etwa 2000 m. In den Zentralalpenschiebt sich ab etwa 1800 m bis zur Waldgrenze der ober-subalpine Lärchen-Arvenwaldüber den Fichtengürtel. Lokal können auch Lärche (Larix decidua), Bergföhre (Pinus montanabzw. Pinus mugo), im Süden auch Buche, in Reinbeständen bis zur Waldgrenze ansteigen.Die Subalpinstufe wird landwirtschaftlich als Sommerweide (Alpwesen) genutzt.Die Temperaturmittel betragen zwischen 0.5 - 3 Grad, die durchschnittliche Schneebedeckung6 - 8 Monate. Entscheidend für den Waldwuchs sind die Temperaturmittel über 5 Grad, welchein der Subalpinzone während 3 - 6 Monaten gegeben sind. (aus STEIGER 1994).Höhenstufen oberhalb des wald- und baumfähigen BereichesOberhalb der Baumgrenze und dem Zwergstrauchgürtel auf 1800 - 2500 m beginnt die Alpinstufe(Rasenstufe). Die alpine Stufe ist durch die Grenze des Vorkommens von zusammenhängendenRasenflecken gegeben. Die Grenze ist eine Wärmegrenze und dürfte ungefähr einermittleren Julitemperatur von 5 Grad entsprechen. Darüber kommen noch Subnivalstufe(Flachpolster-Stufe) und Nivalstufe (Schneestufe) vor. Die obere Grenze der subnivalenStufe liegt an der oberen Grenze der noch regelmässig, aber zerstreut auftretenden Blütenpflanzen(vorwiegend Schuttpflanzen). Die Pflanzen wachsen einzeln und besitzen oft eineflach polsterartige Wuchsform. Die mittlere Dauer der schneefreien Zeit beträgt etwa 2 Monate.(vgl. LANDOLT 1984).Abbildung 20 (auf Folgeseite) zeigt die Höhengrenzen einiger wichtiger Waldbäume und hochalpinerPflanzengruppen. Abbildung 21 (auf Folgeseite) zeigt die Höhenstufen nach LANDOLT(1984) mit einigen Abweichungen zu den oben beschriebenen von STEIGER (1994).44
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus LANDOLT 1984)45
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen3.4 Der Wald als Lebensraum; Naturschutz im WaldDer Wald ist einer der letzten grossflächigen, naturnahen Lebensräume. Ursprünglich warunser Land einmal fast vollständig von Wald bedeckt. Im Mittelalter änderte sich das Bild derWälder gründlich. Der Wald wurde auf einen Viertel der Landesfläche zurückgedrängt undder Rest intensiv genutzt. Je nach Bedürfnissen förderte der Mensch bestimmte Baumarten:seit rund einem Jahrhundert die Fichte für die Holzproduktion, vorher die Eiche für die Schweinemast.Die Tiere des Waldes haben sich unterschiedlich an die herrschenden Lebensbedingungenangepasst. Viele von ihnen sind ausgesprochene Spezialisten und benötigen spezielle Waldtypenoder Strukturelemente im Wald.Dank seinem Reichtum an Vegetationsschichten, Nischen, Strukturen und Pflanzenarten ist erder artenreichste Lebensraum für Vögel. Rund 175 Vogelarten brüten regelmässig in derSchweiz, rund 100 davon im Wald. Etwa 60 leben vollständig im Wald, weitere ca. 12 Artenbrüten im Wald, suchen ihre Nahrung aber ausserhalb (z. B. Hohltauben) und knapp 30 Artenbesiedeln neben dem Wald auch eine Reihe anderer Lebensräume.Trotz der relativen Naturnähe ist auch im Schweizerischen Wald ein Rückgang der Artenvielfaltfestzustellen. So sind von den rund 100 Vogelarten im Wald rund ein Viertel in ihrem Bestandgefährdet.Folgende Hauptfaktoren sind dafür verantwortlich:• Fehlen bestimmter natürlicher Prozesse und Entwicklungsphasen (geringer Alt- und Totholzanteil).• Fehlen lichter, reich strukturierter Wälder.Die heute vorherrschende Hochwaldbewirtschaftung hat zu dunklen, geschlossenen und oftstrukturarmen Wäldern geführt. Dies im Gegensatz zu früheren Nutzungen: Niederwald, Mittelwaldund Waldbeweidung. Ähnlich lichte Waldbilder entstehen auch in der ungestörtenWaldentwicklung, beispielsweise in der Zerfallsphase.• Grossflächig standortfremde Anpflanzungen (Monokulturen).• Einwirkungen von aussen (Störungen, Schadstoffe usw.).So entspricht z. B. der Eintrag von Stickstoff aus der Luftverschmutzung mit rund 40 kg proHektar und Jahr bereits einer in der Landwirtschaft üblichen Düngung.Waldnutzungsformen:Niederwälder: Sie dienen vorwiegend zur Erzeugung von Brennholz und bestehen aus Stockausschlägen,die alle 10 bis 30 Jahre streifenweise kahlgeschlagen werden. Nicht alle Baumarten ertragen das"Auf-den-Stock-setzen". Nadelbäume fehlen deshalb im Niederwald völlig, die Buche verkrüppelt undkümmert. Hagebuche, Linde, Eiche und Ahorn zeigen dagegen gute Ausschlagfähigkeit.Mittelwälder: Der Mittelwald ist ein Niederwald mit einzelnen, aus Kernwüchsen (Sämling, Pflanzung)stammenden, grossen Überhältern: zumeist Eichen, manchmal Buchen und Fichten. Die Eichen und Buchenspenden reichlich Früchte, die der Schweinemast dienten. Die Überhälter können später als BauundMöbelholz genutzt werden. Das Unterholz aus Stockausschlägen wird wie im Niederwald in kurzenAbständen für die Brennholznutzung geschlagen.Hochwald: Der Hochwald wird in der Schweiz seit gut hundert Jahren als Betriebsform bevorzugt. Dasgleichförmige Erscheinungsbild des Hochwaldes wird wesentlich durch die Verjüngungsart mitbestimmt(meist Femelschlag).Plenterwald: Diese Betriebsform zeichnet sich durch einen stark gestuften Bestand aus, in dem auf kleinerFläche alle Altersstufen in bunter Mischung oder kleinen Gruppen vorkommen. Der Plenterwald wirdeinzelstammweise in kurzen Zeitabständen genutzt.(aus STEIGER 1994 und SCHMIDER et al. 1993)46
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenFörster und Waldbesitzer können mit verschiedenen Massnahmen die Artenvielfalt im Waldfördern. Forderungen aus der Sicht des Naturschutzes:• Fördern standortgerechter, in der Regel standortheimischer Baumarten. Keine Fichtenmonokulturen.Geeignete Laubwaldstandorte gezielt mit Eichen verjüngen.Laubwälder sind deutlich reichhaltiger als Nadelwälder! So besiedelt der Pirol nur Laubwälder,der Mittelspecht lebt fast ausschliesslich auf Eichen. Und nicht nur Vögel sind aufLaubwald angewiesen. Am meisten baumbewohnende Fledermäuse wurden bisher auf Buche,Eiche, Vogelkirsche und Esche gefunden.Allgemein ist die Eiche ein ökologisch sehr wertvoller Baum. Er bildet Lebensraum für 70Prozent aller holzbewohnenden Käferarten und wird bezüglich Insektenreichtum nur nochvon alten Weiden übertroffen.• Mit Mischwäldern lässt sich das wirtschaftliche Risiko vermindern und die Bestandesstabilitätvergrössern. Grossflächige Laubmischwälder weisen aber eine viel höhere Artenzahlan Tieren und Pflanzen auf als Mischwälder mit beträchtlichem Nadelholzanteil.• Förderung des Altholzes und des Totholzanteils; Umtriebszeit erhöhen.Um die Altholz-bewohnenden und -nutzenden Tiere zu fördern, muss die Umtriebszeit erhöhtwerden (Eiche > 150 Jahre; Buche > 130 Jahre) und ein Netz von Altholzflächen aufgebautwerden.Alt- und Totholz gehören nicht nur in Waldreservate sondern auch in den Wirtschaftswald.Als Richtwert sollen pro 100 ha rund 3 ha Altholzflächen ausgeschieden werden. Die einzelnenFlächen sollen nicht kleiner als 0.5 ha sein.Begründung: Der Artenreichtum ist abhängig vom Bestandesalter. Alte Bäume bildenden Lebensraum für viele spezialisierte Arten. Die einen benötigen die mächtige Krone oderdie rissige Borke, andere natürliche Höhlen. So benötigt der Schwarzspecht zum Beispieldickstämmiges Altholz. Interessant werden die Buchen und Eichen für Höhlenbewohneraber vor allem im Alter von 140 Jahren; ein Alter, das sie im Wirtschaftswald selten erreichen.Von der Bautätigkeit der Spechte profitiert eine ganze Reihe von Tieren:- Die Hohltaube brütet z. B. sehr gerne in Schwarzspechthöhlen. Sie ist heute selten gewordenund steht als gefährdete Art auf der Roten Liste der CH. (vgl Kap. 7.3).- Kleiber: Er kann Baumhöhlen oder Nistkästen, deren Einfluglöcher zu gross sind, zukleben,damit keine Konkurrenten wie etwa der Star einziehen können.- Trauerschnäpper nutzt auch Spechthöhlen.- Weitere Höhenbewohner sind die häufigen Kohl- und die Blaumeisen. Die kleinereBlaumeise nistet vorwiegend in Höhlen mit 28 mm Fluglochgrösse. Aus den grösserenHöhlen wird sie von den kräftigeren Kohlmeisen verdrängt.- Auch der Waldkauz ist in der Regel ein Höhlenbrüter. Er nutzt zum Teil aber auch alteKrähennester.Weitere Höhlenbewohner sind z. B.:- Fledermäuse (ca. 12 Arten)- Garten- und Siebenschläfer- verschiedene Mäuse- Marder- Hornissen.47
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenTotholz: Um die Totholzfauna zu fördern, soll totes Holz auch ausserhalb der Altholzflächenwenn immer möglich stehen und liegen gelassen werden. Zielgrösse ist 5 - 10 m 3 totesHolz/ha. Auch sollen grössere Wurzelstöcke stehen gelassen werden. Schlagabraumsoll nicht verbrannt werden.Begründung: Der Wald ist ein "Zersetzer-Ökosystem". Pflanzenfresser – von der Blattlausbis zum Reh – verwerten zusammen nur rund ein Fünftel der pflanzlichen Produktion.Die restlichen vier Fünftel gehen in die Nahrungskette der Zersetzer von totem Laub undHolz. Die gesamte davon lebende Unterwelt des Tierreichs wiegt rund hundertmal mehrals alle überirdischen Wirbellosen und Wirbeltiere zusammen.Für die Tierwelt ist totes Holz Edelholz. Viele Insekten, Pilze und andere Organismen lebenzeitweise oder dauernd im Totholz. Oft bilden diese Arten Nahrung für andere Tiereund stehen damit am Anfang einer Nahrungskette.Jede vierte Käferart verbringt einen Teil ihres Lebens in dürrem oder morschen Holz. Dassind gesamthaft rund 1400 Arten. Davon sind 60% gefährdet. Das Insektenangebot wiederumsetzt die obere Limite für den Bestand vieler Vogelarten.Während im Schweizer Mittelland bloss ein halbes Prozent des Holzvorrates morsch unddürr ist, sind im Urwald gut 20%, manchmal gar bis 50% morsch und dürr.Schlagabraum soll als Strukturelement dienen und vermodern können. Solche Haufenschaffen Brut- und Nahrungsplätze (Spinnen, Asseln, Insekten) für die busch- und bodenbrütendenVögel.• Höhlen- und Dürrholzbäume sind als Nist- und Nahrungsgrundlage für viele Tierarten beiNutzungseingriffen gezielt zu schonen. In erster Linie müssen natürliche Höhlen erhaltenwerden. Nisthilfen sind nur Hilfsmittel (Symptombekämpfung, erzieherischer Aspekt). Siewerden nicht von allen Vögeln angenommen.• Erhaltung von Horstbäumen (Greifvögel, Reiher).• Möglichst stufige Waldbestände anstreben.• Die Bestände sollten nach Möglichkeit natürlich verjüngt werden. Da die Naturverjüngungstark vom vorhergehenden Bestand geprägt ist, müssen allenfalls gewünschte Arten durchSaat oder Pflanzung nachgezogen werden.Pionierwaldflächen sind Insektenparadiese.Jungwaldpflege soll nur ausserhalb der Brutzeit (April-Juni) und nach Möglichkeit zeitlichgestaffelt ausgeführt werden.• Waldränder aufwerten:Als Grenzraum zwischen zwei unterschiedlichen Lebensräumen (Ökoton) ist ein vielfältiggestufter und gebuchteter Waldrand ökologisch äusserst wertvoll.Waldränder sind Rückzugsgebiete für viele Pflanzen und Tiere. (Insektenreichtum, viele Vögel,Säugetiere wie Haselmaus. Auch Ameisen bauen ihre Haufen häufig am sonnigenWaldrand.)Der Grossteil der Waldränder präsentiert sich aber als scharfe Grenze zwischen Hochwald48
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgenund intensiv genutztem Landwirtschaftsland oder Strasse/Weg. Ein vorgelagerter, extensivgenutzter Krautsaum fehlt weitgehend. Das Potential dieses Ökotons zeigt sich darin, dasses im Mittelland rund 40'000 km Waldrand gibt, was ungefähr dem Erdumfang entspricht.Bei den Waldrändern sollte folgendes beachtet werden:- Bestehende stufige Waldränder erhalten; keine Wege und Strassen entlang Waldrändernanlegen, keine Begradigung.- Neue breite, stufige Waldränder anlegen. Besonders geeignet sind südexponierte Lagen.Wichtig: Strukturreichtum und Verzahnung von Waldmantel, Strauchgürtel und Krautsaum.Buchten anlegen.- Lichtungen im Wald am Rand stufig aufbauen.- Sträucher selektiv und abschnittsweise zurückschneiden. Krautsaum abschnittsweise mähen(mindestens alle 3 Jahre einmal, maximal einmal pro Jahr).• Waldentwicklungsplan WEP: Lenkung der Waldnutzung.Der Erholungsdruck im Wald ist gross. Erschliessungsstrassen fördern Störungen.Deshalb soll die Erschliessungsdichte so gering wie möglich gehalten werden.- Die Erschliessung schutzwürdiger und empfindlicher Waldgebiete ist zu vermeiden.- Alternativen prüfen (Seilkran, Einsatz von Pferden etc.).- Keine zweckfremde Nutzung der Bewirtschaftungswege: Fahrverbot.- Waldstrassen möglichst nicht mit Festbelag bauen.Oft werden Waldflächen vielseitig genutzt und haben gleichzeitig verschiedene Aufgaben zuerfüllen. Mit dem Instrument des Waldentwicklungsplans WEP sollen Vorranggebiete fürdie einzelnen Funktionen ausgeschieden werden (z. B. Schutzfunktion, Wohlfahrtsfunktion,Nutzfunktion z. B. mit naturnahem Waldbau als Grundnutzung). Weiter können bewirtschafteteNaturvorranggebiete und Naturwaldreservate ausgeschieden werden.Ausscheiden von Naturwaldreservaten (Ziel ca. 10%): Verzicht auf jegliche Bewirtschaftungund Pflege mit dem Ziel einer freien Waldentwicklung. In der Schweiz liegt der heutigeAnteil bei rund 0.5% der gesamten Waldfläche.Ausscheiden von bewirtschafteten Naturvorranggebieten (Ziel ca. 8%): Waldflächen mitgezielten Eingriffen zur Erhaltung und Förderung spezieller ökologischer Werte:- Spezielle Waldnutzungsformen wieder aufleben lassen (Mittelwald, Niederwald, Plenterwald).- Waldpartien auflichten, lichte Wälder fördern.- Wälder auf Sonderstandorten sowie seltene und gefährdete Waldgesellschaften, die Pflegeeingriffebrauchen, erhalten, aufwerten und fördern (Eichenmischwälder, Orchideen-Buchenwälder, Orchideen-Föhrenwälder, Lindenmischwälder, Flaumeichenwälder,Bruch- und Moorwälder, Auenwälder etc.).Diese Flächen sollten im Waldentwicklungsplan (WEP) ausgeschieden werden.Das Waldgesetz (WaG) verlangt, dass der Wald naturnah zu bewirtschaften ist, damit er seineFunktion als Lebensraum für Pflanzen und Tiere und als Teil der Landschaft dauernd erfüllenkann. Die Waldverordnung (WaV Art. 19) sieht finanzielle Beiträge an den sogenanntenWaldbau A vor, der auch Aufwertungsmassnahmen im stufigen Waldrand umfasst.49
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenGehölzarten in England und die auf ihnen lebenden pflanzenfressendenInsektenarten (nach KENNEDY und SOUTHWOOD 1984)LaubgehölzeNadelgehölzeWeiden (mehrere Arten) 450Eichen (2) 423Birken (2) 334Weissdorn 209Pappeln (4) 189Schwarzdorn 153Schwarzerle 141Ulmen (2) 124Wildapfel 118Hasel 106Buche 98Waldföhre 172Esche 68Vogelbeere 58Linden (2) 57Feldahorn 51Hagebuche 51* Bergahorn 43Fichte 70* Lärche 38Wacholder 32* Edelkastanie 11Stechpalme 10* Rosskastanie 9* Nussbaum 7* Robinie 2Eibe 6*: In England in den letzten Jahrhunderten eingeführte Gehölzarten50
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen3.5 Der Auerhahn (autökologische Betrachtungen)(aus BUWAL und SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE SEMPACH 1993)Das Auerhuhn ist bedroht. Um 1970 balzten in der Schweiz noch mindestens 1100 Hähne; 15Jahre später wurde der Frühlingsbestand bloss noch auf 550 bis 650 Hähne geschätzt. Seithergibt es Hinweise auf weitere Bestandesabnahmen, in Einzelfällen gar auf das Verschwindender Art aus Atlasquadraten zwischen 1993 und 1996. Selbst in Schwerpunktregionen desAuerhahns, wie im Waadtländer Jura und im Kanton Schwyz, gingen die Bestände zurück undhaben sich nur noch in den Populationszentren gehalten. Die Verinselung der Populationenund die Zunahme der Meldungen über balztolle Vögel geben zusätzlich zu Besorgnis Anlass.Der Rückgang wird hauptsächlich auf Habitatsveränderungen und menschliche Störungen zurückgeführt.(SCHMID et al. 1998).Das Auerhuhn steht gesamtschweizerisch unter Schutz; es darf seit 1964 also nicht mehr bejagtwerden. Gefährdungsursachen sind:- Störungen (durch Wanderer, Pilz- und Beerensammler, Skifahrer, Mountain-Biker, Gleitschirmflieger,Orientierungsläufer, Fotografen, Ornithologen etc.).- Wald-Erschliessungen und waldbauliche Massnahmen, die den Ansprüchen des Auerhahnsnicht Rechnung tragen.51
3 Ökosystem Wald Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen52
4 Vergleich Wald / Schlagfläche Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen4 Vergleich Wald / Schlagfläche (aus GILGEN 1994)Tab. 18. Primäre und sekundäre Auswirkungen eines Schlagereignisses. Vergleich vonWaldbeständen mit jungen Schlagflächen mittlerer Grösse. Resultatzusammenfassung.++ starke Zunahme - great increase+ leichte Zunahme - slight increase= gleichbleibend - no change- leichte Abnahme - slight decrease-- starke Abnahme - great decrease+ bis - Zunahme bis Abnahme - increasing to decreasingBeurteilungspunkteVeränderungen in der Schlagflächegegenüber dem WaldLichtfluss bei Sonnenschein ++Lichtfluss bei starker Bewölkung =Niederschlagsmenge +Wind + bis ++Tagestemperatur bei Sonnenschein + bis ++Tagestemperatur bei starker Bewölkung =Tagestemperatur in Krautschicht bei Sonnenschein ++Tagestemperatur in 200 cm Höhe bei Sonnenschein +Temperaturschichtung bei Sonnenschein + bis ++Temperaturschichtung bei starker Bewölkung =Temperatur in klaren Nächten - bis - -Nachttemperatur bei bedecktem Himmel =rel. Luftfeuchtigkeit bei Sonnenschein -rel. Luftfeuchtigkeit in klaren Nächten in Bodennähe ++rel. Luftfeuchtigkeit in klaren Nächten in 200 cm Höhe = bis +abs. Luftfeuchtigkeit bei Sonnenschein in Bodennähe + bis ++Bodentemperatur (in 10 cm Tiefe) bei Sonnenschein ++Bodentemperatur (in 10 cm Tiefe) in der Nacht +Nährstofffreisetzung +Wassergehalt im Boden +Wassergehalt im Boden (oberster Auflagehorizont) + bis -standörtliche Vielfältigkeit +Anzahl Pflanzenarten ++Waldarten = bis +lichtbedürftige Arten ++Samenvorrat ++MikroklimaBoden53
4 Vergleich Wald / Schlagfläche Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus GILGEN 1994)54
5 Landschaftsentwicklung Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen5 Landschaftsentwicklung55
5 Landschaftsentwicklung Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen56
5 Landschaftsentwicklung Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus STERN et al., 1980)57
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen6 Naturschutz6.1 Artenentwicklung58
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen6.2 Biotopinseln, Inseltheorie59
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus MÜLLER und BERTHOUD 1995)60
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen61
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenHeute sind in der Schweiz nur noch wenige grössere, zusammenhängende naturnahe Flächen vorhanden.Es sind dies vor allem Waldgebiete, alpine Regionen und einige wenige Feuchtgebiete. NaturnaheLebensräume in der Zivilisationslandschaft werden durch Siedlungen, Strassen, Industriegebiete,Sportanlagen und landwirtschaftliche Intensivkulturen voneinander isoliert. Unsere Landschaftbesteht also aus vielen verschiedenen, natürlichen und anthropogenen Biotopinseln (Habitatinseln,vgl. Abb. 13). Verkehrswege, Siedlungen etc. sind für viele Tier- und Pflanzenarten unüberwindbareHindernisse, bedeuten also ökologisch grosse Entfernungen (vgl. Abb. 14). Zwischen den getrenntenTierpopulationen ist der genetische Austausch reduziert, was beim Unterschreiten einer kritischen Populationsgrössezu einem Mangel an genetischer Vielfalt führt. Inzucht kann eine Population vollständigzum Erliegen bringen.Je grösser eine Biotopinsel, desto grösser ist im Allgemeinen die Artenzahl der Tiere. Dies hängt u. a.mit dem Minimalraum der Tiere zusammen (vgl. Tab. 2). Schon eine Grillenpopulation benötigt in Süddeutschlandzum Überleben 3 ha zusammenhängende Trockenrasen. Zusätzlich ist der Anteil an gestörterRandfläche umgekehrt proporzional zur Flächengrösse; je kleiner die Fläche, desto grösser derAnteil an gestörter Randfläche. Der Randeinfluss beträgt im Wald bis 40 m.Teilweise kann zwischen isolierten Lebensräumen über sogenannte "Trittsteine" (Hecken, Bäche,Wald- und Wegränder, Einzelbäume, usw.) ein gewisser genetischer Austausch noch bestehen. Nebender Erhaltung möglichst grosser, natürlicher Biotope ist es deshalb auch besonders wichtig, solcheLandschaftselemente als ökologische Ausgleichsflächen und Vernetzungselemente zu erhaltenund bewahren. (aus BUWAL 1994 und GIGON 1987)62
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen6.3 Rote Listen(aus LANDOLT 1991)63
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus LANDOLT 1991)(aus LANDOLT 1991)(aus LANDOLT 1991)64
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen65(aus LANDOLT 1991)
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1994)66
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen67
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1994)68
6 Naturschutz Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen6.4 Blaue ListeErgänzung "Blaue Listen" (Liste der erfolgreich erhaltenen oder geförderten Tier- und Pflanzenartender Roten Listen):• Neues Instrument für die Technologiefolgen-Abschätzung im Naturschutz. Welche Wirkung hat derpraktische Naturschutz auf die Erhaltung und Förderung von Arten der Roten Liste?• Die Anteile von Arten in den Kategorien "Bestandesstabilisierung und -zunahme durch Natur- undUmweltschutztechniken" könnten relativ leicht verdoppelt werden, denn für weitere 61 Tier- und 180Pflanzenarten gibt es bereits im Testgebiet lokal erprobte Natur- und Umweltschutztechniken. Dasie auf der lokalen Ebene erfolgreich waren, könnten durch eine breite Anwendung dieser Technikenauch die Bestände in einem grösseren Gebiet stabilisiert oder vergrössert werden.• Aus der Tatsache, dass viele Einzelarten erfolgreich gefördert werden können, darf nicht geschlossenwerden, dass ein ganzer degradierter Lebensraum ohne weiteres renaturiert werden kann.• Der relativ hohe Anteil an erfolgreich erhaltenen und geförderten Arten (Blaue Liste-Arten, ca. 50%)könnte den Eindruck erwecken, es genüge für den Schutz der Natur, lokal bestimmte Natur- undUmweltschutztechniken einzusetzen: hier eine Hecke pflanzen, dort einen Weiher anlegen. Naturschutzdarf sich jedoch nicht auf Einzelmassnahmen beschränken. Es gibt verschiedene Arten (v. a.von Vögeln und Säugetieren), die sich erst mit grossräumigen landschaftsökologischen Aufwertungenwirksam erhalten oder fördern lassen.69
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum)7.1 Was heisst naturnahe Gestaltung?(aus BUWAL 1995)70
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen7.2 Rechtliche Grundlagen und Instrumente (aus BUWAL 1995)71
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenWeitere Instrumente:• Ortsplanung der Gemeinden mit Zonenplan, Bauordnung, Sondernutzungspläne, Naturleitbilder (z. B.mit Aus- und Umzonungen von Schutzobjekten, Baumschutz, Pflicht für Flachdachbegrünung, offeneWegbeläge etc.)• Finanzielle Anreize, z. B. verursacherbezogene Abwassergebühren gemäss USG• Naturnahe Objektplanung und Grünpflege: Gute Vorbilder bei öffentlichen Bauten und Anlagen geben,private Initiativen unterstützen, Öffentlichkeitsarbeit.72
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen7.3 Planen und Projektieren (aus BUWAL 1995)73
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1995)74
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1995)75
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen7.4 Massnahmen (Beispiele)(aus BUWAL 1995)76
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1995)77
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen78
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1995)79
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1995)80
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen(aus BUWAL 1995)81
7 Naturnahe Gestaltung (Beispiel Siedlungsraum) Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenBeim Bau neuer Mauern ist auf Folgendeszu achten:(aus BUWAL 1995)82
8 Einige Fragen Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen8 Einige FragenWas ist eine Vegetationsaufnahme?Was ist eine Pflanzengesellschaft?Wie unterscheiden sich die beiden in der Ökologie verwendeten Begriffe "Flora" und "Vegetation"voneinander?Wie unterscheiden sich die beiden in der Ökologie verwendeten Begriffe "Standort" und "Fundort"voneinander?"Primärkonsumenten", "Sekundärkonsumenten" und "Tertiärkonsumenten" haben unterschiedlicheNahrungsquellen. Wovon ernähren sie sich?Welches sind die Gemeinsamkeiten von Konsumenten und Destruenten? Warum werden dieseOrganismengruppen nicht zusammengefasst?Was sind Symbiosen?Nennen Sie Symbiosen zwischen Pilzen und anderen Organismengruppen?Welche Funktion haben die Pilze in diesen Symbiosen?Nennen Sie den Unterschied zwischen physiologischem und ökologischem Optimum?Wie unterscheidet sich ein pflanzlicher Vollschmarotzer von einem pflanzlichen Halbschmarotzer?Auf welchen Standorten kommen tierfangende (carnivore) Pflanzenarten vor? Warum?Die Waldföhre wächst an Extremstandorten (z. B. auf sehr trockenen und sauren Böden odersehr nassen und sauren Böden). Ist sie deshalb als konkurrenzstarke Art anzusehen? BegründenSie.Warum ist die Buche so konkurrenzfähig?Die Aufrechte Trespe (Bromus erectus) ist ein Trockenheitszeiger. Was bedeutet dies?Was bedeutet der Begriff "Sukzession"? Wie unterscheiden sich primäre und sekundäre Sukzessionvoneinander?Nennen Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Pionierökosystem oder Landwirtschaftsökosystemund einem Schluss-Ökosystem bezüglich Artenzahl, Biomasse, Nahrungsbeziehungen,Produktion (NÖP) und Stabilität.Gemäss den Roten Listen sind durchschnittlich 40% der Tierarten, aber nur 25% der Blütenpflanzengefährdet. Weshalb sind mehr Tierarten gefährdet?Nennen Sie die wichtigsten Ursachen des Artenrückgangs.Welche generelle Funktion besteht zwischen der Flächengrösse eines Lebensraumes und derZahl der Pflanzenarten, die darin leben?Naturschutz ist oftmals Kulturschutz. Begründen Sie.Fragen aus 1. Vordiplom Herbst 2000Wie unterscheiden sich die beiden in der Ökologie verwendeten Begriffe "Flora" und "Vegetation"voneinander?"Primärkonsumenten", "Sekundärkonsumenten" und "Tertiärkonsumenten" haben unterschiedlicheNahrungsquellen. Wovon ernähren sie sich?83
8 Einige Fragen Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenFlechten entstehen durch eine ökologische Interaktion zwischen artverschiedenen Organismen.a Wie heisst diese Interaktion?b Welche Organismen sind bei dieser Interaktion beteiligt?c Wie sieht die Arbeitsteilung zwischen den beiden artverschiedenen Organismen aus?Interpretieren Sie dieses Ökogramm der Waldföhre auf S. 23. Nennen Sie einige typischeStandorte der Waldföhre in der Schweiz.Warum sollten aus der Sicht des Naturschutzes möglichst viele "Lothar-Sturmflächen" nichtgeräumt werden? Wie wird sich die Pflanzenartenzahl auf einer solchen Sturmfläche entwickeln?Übung 1: Interpretation der Zeigerwerte der Rotbuche (Fagus sylvatica):F3 Rx N3 H3 D4 L2 T3 K2 WpWo kommt die Buche vor, wo nicht?Übung 2: Fragen zur Abb. 2 auf Seite 35: Ökosystem Wald (Biomasse und Fluxe)1a) Wie gross ist die Nettoprimärproduktion (NPP) eines 120-jährigen mitteleuropäischenLaubmischwaldes?1b) Wieviel Prozent der NPP ist Bestandesabfall?1c) Wieviel Prozent der NPP geht in Weidenahrungskette?1d) Wieviel Prozent der NPP ist Biomassezuwachs?2) Wie gross ist die NÖP?3) Welches ist die Phytophagennahrungskette?4) Wo sind die Saprophagen, wo die Destruenten?84
9 Literatur Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. Gilgen9 LiteraturBAUER E. W., 1982: Biologiekolleg. CVK, Berlin. S. 464.BICK H., 1998: Grundzüge der Ökologie. 3. überarb. und erg. Auflage. Gustav Fischer VerlagStuttgart, Jena, Lübeck, Ulm. 368 S.BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Hrsg.), 1991: Rote Liste. Die gefährdetenund seltenen Moose der Schweiz. EDMZ, Bern. 56 S.BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Hrsg.), 1994: Rote Liste der gefährdetenTierarten der Schweiz. EDMZ, Bern. 97 S.BUWAL (Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Hrsg.), 1995: Naturnahe Gestaltungim Siedlungsraum. Leitfaden Umwelt Nr. 5. EDMZ, Bern. 114 S.BUWAL und SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE SEMPACH (Hrsg.), 1993: Merkblatt Waldwirtschaftund Auerhahn. EDMZ, Bern. 18 S.ELLENBERG H., 1986: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 4., verbesserte Aufl. UlmerStuttgart. 989 S.GIGON A., 1984: Vorlesungsskript.GIGON A., 1987: Vorlesungsskript Grundlagen der Landschaftsplanung, ORL-Institut ETHZ.GIGON A., LANGENAUER R., MEIER C. und NIEVERGELT B., 1996: "Blaue Listen" der erfolgreicherhaltenen oder geförderten Tier- und Pflanzenarten der Roten Listen. Mit Hinweisenzur Förderung gefährdeter Arten. Schweizerischer Wissenschaftsrat. Bern, 96 S. + 117 S. Anhang.GILGEN R., 1994: Pflanzensoziologisch-ökologische Untersuchungen an Schlagfluren imschweizerischen Mittelland über Würmmoränen. Veröff.Geobot.Inst.ETH, Stiftung Rübel, Zürich116. 128 S.HEINRICH D. und HERGT M., 1998: Ökologie. dtv-Atlas. 4. Aufl. 287 S.IMBODEN C., 1976: Leben am Wasser. Kleine Einführung in die Lebensgemeinschaften amWasser. Verlag Schweizerischer Bund für Naturschutz, Basel. 240 S.KNODEL H. und KULL U., 1981: Ökologie und Umweltschutz. 2., neubearb. und erweiterteAufl. J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 228 S.LANDOLT E., 1977: Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff.Geobot.Inst. ETH,Stiftung Rübel, Zürich 64. 208 S.LANDOLT E., 1984: Unsere Alpenflora. 5., vollständig neu bearb. Aufl. Verlag des SAC.318 S. + 120 Tafeln.LANDOLT E., 1991: Rote Liste. Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz.BUWAL (Hrsg.). EDMZ, Bern. 185 S.LAUBER K. und WAGNER G., 1996: Flora Helvetica. Haupt, Bern. 1616 S.85
9 Literatur Vorlesung Einführung terrestrische Ökologie, R. GilgenMÜLLER S. und BERTHOUD G., 1995: Sicherheit Fauna/Verkehr. Praktisches Handbuch fürBauingenieure. EPFL, Laboratoire des voies de circulation (LAVOC). 135 S.REMMERT H., 1992: Ökologie. 5., neubearb. und erweiterte Aufl. Springer-Verlag, Berlin,Heidelberg, New York. 363 S.SCHERF G., 1997: Wörterbuch Biologie. dtv München. 512 S.SCHLEGEL H.G., 1985: Allgemeine Mikrobiologie. 6., überarb. Aufl. Georg Thieme Verlag,Stuttgart, New York. 571 S.SCHMID H., LUDER R., NAEF-DAENZER B., GRAF R. und ZBINDEN N., 1998: SchweizerischerBrutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein1993-1996. Schweizerische Vogelwarte Sempach, Sempach. 574 S.SCHMIDER P., KÜPER M., TSCHANDER B. und KÄSER B., 1993: Die Waldstandorte imKanton Zürich. Waldgesellschaften, Waldbau, Naturkunde. Vdf, Zürich. 287 S.STEIGER P., 1994: Wälder der Schweiz. Ott Verlag, Thun. 359 S.WILDERMUTH H., 1985: Natur als Aufgabe. Leitfaden für die Naturschutzpraxis in der Gemeinde.SBN, Basel. 298 S.86