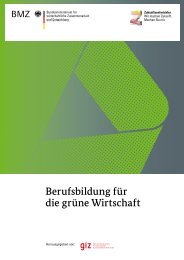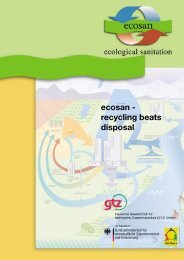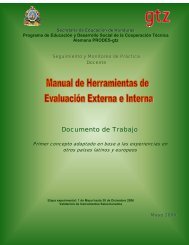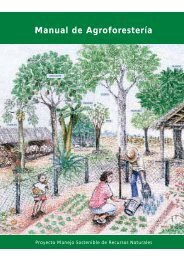Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ungefähr zur gleichen Zeit spricht Genet zum ersten<br />
Mal über ihren Status mit einem Fremden. Ein älterer<br />
Mann macht sie im Minibus an und lädt sie zu einem<br />
Kaffee ein. Er eröffnet ihr, dass er gerne mit ihr schlafen<br />
würde, da sie jung und hübsch sei und seine eigene Frau<br />
alt und hässlich. Genet erklärt sich. Zunächst ist der<br />
Mann geschockt. Genet: „Ich sagte ihm, dass ich wie<br />
seine Frau bin. Er solle aufhören, anderen Frauen nachzusteigen<br />
und seine Frau zu gefährden. Er verstand mich<br />
und hatte Mitleid mit mir. Nach diesem Tag habe ich das<br />
allen Männern erzählt, die mit mir schlafen wollten.“<br />
2003 outet sich Genet zum ersten Mal in aller Öffentlichkeit.<br />
Sie fängt an, verschiedene Iddir zu besuchen<br />
und dort ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Ein Iddir<br />
ist eine lokale, meist informelle soziale Sicherungsstruktur,<br />
der üblicherweise 200–300 Haushalte angehören.<br />
Im Todesfall wird die in Äthiopien sehr teure Beerdigung<br />
von den Iddirs ausgerichtet und bezahlt, die Hinterbliebenen<br />
bekommen eine Abfindung. Einmal im<br />
Monat findet eine Mitgliederversammlung statt, zu der<br />
verpflichtend alle Haushalte kommen müssen. Eine<br />
gute Möglichkeit also auch über HIV zu sprechen.<br />
Genet: „Eines Tages habe ich eine Veranstaltung in<br />
einem Iddir gemacht. Jeder fühlte sich schlecht, einige<br />
haben auch geweint. Als ich nach Hause kam, fand ich<br />
alle meine Sachen auf der Straße. Die Hausbesitzerin<br />
war in dem Iddir. Ich habe sie gefragt: ,Warum?‘ Sie<br />
sagte: ,Weil Du HIV-positiv bist.‘“<br />
Die Diskriminierung von HIV-Positiven war zu jener<br />
Zeit enorm stark in der äthiopischen Gesellschaft. Jeglicher<br />
Körperkontakt wurde vermieden, sei es das Händeschütteln<br />
als Begrüßung, sei es das gemeinsame Essen.<br />
HIV-Positive wurden in Cafés nicht geduldet, das Virus<br />
könne ja vom Stuhl auf andere Gäste „überspringen“.<br />
Fast alle HIV-Positiven verloren zu dieser Zeit ihre<br />
Wohnung.<br />
Aufklärungsarbeit von HIV-Positiven<br />
in ihrer Nachbarschaft<br />
Fünf Jahre später hat sich die Situation deutlich verbessert.<br />
Die Diskriminierung ist durchaus noch vorhanden,<br />
doch die Menschen sind besser aufgeklärt, haben eine<br />
viel genauere Vorstellung von den Übertragungswegen.<br />
Der zwischenmenschliche Umgang beginnt sich zu<br />
normalisieren, aber nach wie vor ist es schwierig, eine<br />
Wohnung zu finden. So gut wie alle erwachsenen<br />
Obdachlosen in Addis sind<br />
HIV-positiv!<br />
Besonders in den letzten zwei Jahren ist<br />
eine deutliche Veränderung insofern zu erkennen,<br />
als dass die Menschen viel offener<br />
über HIV und auch über Sexualität sprechen<br />
können. Großen Anteil an dieser<br />
Veränderung haben Ansätze auf Gemeindeebene.<br />
Insbesondere durch das Outing von<br />
HIV-Positiven und ihre Aufklärungsarbeit<br />
bei den Nachbarn, das heißt in einer Sprache<br />
und Form, die die Bevölkerung versteht,<br />
bekommt die Zielgruppe einen eigenen<br />
Zugang.<br />
Empirische Untersuchungen über einen<br />
Zeitraum von drei Jahren zeigen, dass insbesondere<br />
Genet und ihre NRO viel dazu<br />
beigetragen haben, dass die Menschen<br />
in Genets Viertel Mekanisa viel offener über HIV reden,<br />
als die in anderen Vierteln. Mittlerweile wird diese Idee<br />
auch von anderen Organisationen umgesetzt: Seit etwa<br />
drei Jahren gibt es in allen Stadtvierteln Home-Based-<br />
Care-Gruppen. Das sind Gruppen von Freiwilligen, meist<br />
jungen Erwachsenen, die sich für 18 Monate verpflichten,<br />
bettlägerige Kranke in ihrem Stadtteil zu versorgen. Sie<br />
werden zum Arzt gebracht; es wird aufgepasst, dass sie<br />
ihre Medikamente regelmäßig einnehmen; es wird aber<br />
auch gekocht, geputzt, gefüttert und eingekauft. Ursprünglich<br />
wurden diese Gruppen als Reaktion auf AIDS<br />
eingerichtet, mittlerweile werden jedoch auch andere<br />
Bettlägerige versorgt. Der Home-Based-Care-Ansatz stellt<br />
ein Novum für die äthiopische Gesellschaft dar: Hauptsächlich<br />
kümmert sich die Familie um Kranke, auch die<br />
enge Nachbarschaft und Freunde helfen mit. Nun kümmern<br />
sich zum ersten Mal Fremde ehrenamtlich um<br />
Fremde. Eine so intensive Versorgung bleibt natürlich<br />
auch von den Nachbarn nicht unbeobachtet. Um Gerüchte<br />
zu vermeiden, wird die Nachbarschaft von der<br />
Home-Based-Care-Gruppe zu einer traditionellen Kaffeezeremonie<br />
eingeladen. Bei frisch gebrühtem Kaffee und<br />
Popcorn wird ungezwungen über HIV aufgeklärt, die<br />
Übertragungs- und Vermeidungswege werden diskutiert<br />
und auch schon mal gezeigt, wie ein Kondom verwendet<br />
wird. Zu diesen Treffen werden häufig HIV-Positive aus<br />
anderen Vierteln als Gäste geladen, um aus ihrem Leben<br />
© Till Winkelmann<br />
28 29<br />
Die Ärmsten der Armen<br />
haben häufig keinen<br />
Zugang zu Aufklärungsmedien.