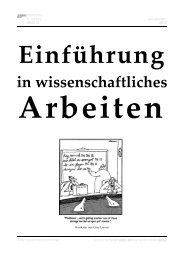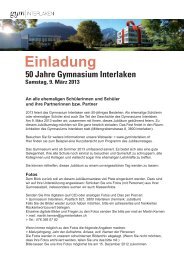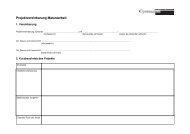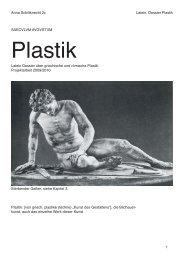Mythologie Titelblatt - Gymnasium Interlaken
Mythologie Titelblatt - Gymnasium Interlaken
Mythologie Titelblatt - Gymnasium Interlaken
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
34 Narziss und Echo Mythen und Mythendeutung<br />
keit’, gegen welche „Unfähigkeit”, so meine ich, den positiven Charakter von Verweigerung erhält.<br />
[G. Dischner, Ein Gegenbild zum „eindimensionalen Menschen”, in: Häsing, Stubenrauch, Ziehe (Hrsg.): Narziss, ein neuer Sozialisationstypus? Pädagogik<br />
extra Verlag. Bensheim 1981, S. 100ff.]<br />
Peter Passett: Gedanken zur Narzissmuskritik<br />
Die entfremdeten Bedingungen, unter denen heute eine überwiegende Mehrheit der Menschen zu leben und<br />
zu arbeiten gezwungen ist, und der gewaltige, entpersönlichte bürokratische Apparat, der uns alle verwaltet, ver-<br />
hindern unsere Triebbefriedigung im engen Sinne nicht, sondern machen sich im Gegenteil anheischig, sie so gut<br />
wie nie zuvor in der Geschichte für alle zu garantieren. Und es fällt relativ schwer, dies zu bestreiten. Aber dadurch,<br />
dass wir nur noch Funktionen sind, komplett verwaltet, dass alle möglichen Befriedigungen nur in vorgegebenen<br />
Bahnen erfolgen können, werden wir zutiefst frustriert in unserem Anspruch auf Einmaligkeit und Individualität.<br />
Wir leben ja nicht, wie gewisse aussereuropäische Gesellschaften, in einer und für eine Gruppe, welche jene nar-<br />
zisstische Besetzung hätte, die bei uns das Individuum geniesst. Die Apparate, die vorgeblich um unseretwillen be-<br />
stehen, sind uns fremd und erscheinen feindlich. Durch die Arbeit, die für die meisten keine emotionale Beteiligung<br />
erlaubt, werden die Menschen ausgelaugt und gezwungen, ihre Hohlheit mit jenem Abfall auszufüllen, den das Sy-<br />
stem auswirft, und in ausbeuterischer Weise die notwendige Selbstbestätigung sich im Rahmen der intimen, vor<br />
allem der familiären Beziehungen, welche nicht ganz so verwaltet sind, zu holen. Man versucht, sich am Partner<br />
und in erster Linie an den Kindern schadlos zu halten. So kommt denn jene narzisstische Ausbeutung zustande,<br />
welche meiner Meinung nach Miller durchaus zu Recht beschreibt, aber wegen ihrer Indifferenz gegenüber gesell-<br />
schaftlichen Bedingungen fälschlicherweise nur in der geschlossenen Mutter-Kind-Dyade lokalisiert.<br />
Sucht ist in dieser Sichtweise die systemkonforme Art, durch Konsum „unnötiger” Güter, die das System pro-<br />
duzieren muss, um sich zu erhalten, jene Löcher im Selbstgefühl zu stopfen, die vorwiegend dadurch entstehen,<br />
dass man sich in diesem System nur schwer als Zentrum eigener Aktivität, als Individuum erleben kann. Sie ist mei-<br />
ner Meinung nach die narzisstische Störung par excellence, jene Störung, welche wegen ihres engen Bezugs zum<br />
System überhaupt nur noch in einigen wenigen, willkürlich ausgegrenzten Formen als Störung erkannt wird.<br />
Anders herum gesagt: Sucht ist ein tragisch scheiternder Versuch, Entfremdung aufzuheben. Ihr Zweck, den<br />
sie nicht erreichen kann, ist es, jenen Widerspruch zu negieren, der dadurch entstanden ist, dass die Verhältnisse,<br />
die ursprünglich zum Ziel hatten, das Leben zu erleichtern, zu ihren einstigen Intentionen in Gegensatz geraten<br />
sind (die gesellschaftliche Organisation der Arbeit), weil sie zu Herrschaftsverhältnissen verkamen. Die gesell-<br />
schaftliche Organisation der Arbeit, wie sie heute besteht, hat zwar die materiellen Nöte für einen Teil der Men-<br />
schen aufgehoben - allerdings nur für einen kleineren -, aber um den Preis der psychischen Verstümmelung, die<br />
darin besteht, dass kaum noch Beziehungen zu Menschen und Dingen möglich sind, in denen man sich in seiner<br />
Einmaligkeit als Individuum erleben kann.<br />
Der Druck dieser Verhältnisse lastet in doppelter Weise auf den Menschen: zum einen, indem er ihre Eltern in<br />
einem so hohen Masse narzisstisch bedürftig macht - um den Terminus hier nun ganz bewusst in seiner schillern-<br />
den Vieldeutigkeit zu verwenden -, dass sie nicht in der Lage sind, sich ihren Kindern in wichtigen Entwicklungs-<br />
phasen als jene Selbstobjekte zur Verfügung zu stellen, die die Kinder nötig hätten, um durch deren Spiegelung und<br />
die an ihnen mögliche Idealisierung und phasengerechte Enttäuschung zu Individuen zu werden, die ihr eigenes<br />
Selbstwertgefühl befriedigend regulieren können. Zum anderen aber machen diese Verhältnisse selbst einem gros-<br />
sen Teil der Privilegierten, deren Eltern ihnen gegenüber in diesen Funktionen nicht oder doch nicht vollständig<br />
versagen mussten, die Aufrechterhaltung eines solchen „gesunden” narzisstischen Gleichgewichtes unmöglich,<br />
weil ein solches Gleichgewicht, wie Kohut einleuchtend beschrieben hat, nicht nur von einer optimalen Entwick-<br />
lung abhängt, sondern lebenslänglich darauf angewiesen bleibt, durch Spiegelung und die Möglichkeit von Ideali-<br />
sierung aufrechterhalten zu werden. Diese Möglichkeiten aber sind kaum mehr gegeben.<br />
[P. Passett: Gedanken zur Narzissmuskritik: Die Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten. in: Die neuen Narzissmustheorien: zurück ins Paradies? Hrsg.<br />
vom Psychoanalytischen Seminar Zürich, Syndikat Buchges. Frankfurt 1981, S. 159ff.]