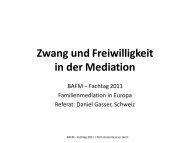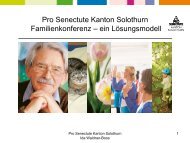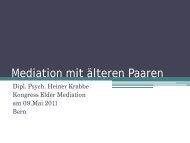impuls - Soziale Arbeit - Berner Fachhochschule
impuls - Soziale Arbeit - Berner Fachhochschule
impuls - Soziale Arbeit - Berner Fachhochschule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
schied die unwürdigen von den würdigen.<br />
Letztere erhielten Solidarität, Erstere wurden<br />
unterdrückt. Zwischen 1500 und 1800<br />
wurden erstmals politische Massnahmen<br />
zur Armutslinderung ergriffen. Es wurden<br />
Armen und Zuchthäuser gegründet;<br />
die Finanzierung von Bedürftigen über die<br />
Heimatgemeinde wurde eingeführt. Mit<br />
zunehmender Industrialisierung und Mobilität<br />
im 19. Jahrhundert versagte aber das<br />
Heimatgemeindeprinzip. Um 1900 kam es<br />
zur langsamen Herausbildung eines Sozialversicherungssystems<br />
und einer Ursachen<br />
bekämpfenden Sozialpolitik.<br />
Anreizmodelle<br />
aus ökonomischer Sicht<br />
Laut Dr. Sonia Pellegrini, wissenschaftliche<br />
Mitarbeiterin am Fachbereich <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>, ist Sozialhilfe als staatliche Dienstleistung<br />
der Aufwandoptimierung punkto<br />
Zeit und Geld, zielgerechtem Mitteleinsatz<br />
und den wirksamsten Massnahmen verpflichtet.<br />
Als Instrumente zur Effizienzsteigerung<br />
sind laut Pellegrini Anreizmodelle<br />
gegenüber stark kontrollierenden Ansätzen<br />
vorzuziehen, da sie ausschliesslich das<br />
Ziel festlegen. Folgende Anreizmodelle<br />
könnten sich – im Vergleich zu einem<br />
Selbstbehaltssystem – positiv auf die Ressourcennutzung<br />
auswirken:<br />
– Allgemeine Effizienzsteigerungsanreize:<br />
Das Ziel ist eine Kostensenkung bei<br />
gleicher Qualität. Angesprochen sind<br />
mögliche Fusionen oder Reorganisa tionen<br />
von Sozialdiensten.<br />
– BenchmarkingSystem: Ziel ist, mittels<br />
Effizienzgrad die besten Praktiken von<br />
anderen Gemeinden zu identifizieren und<br />
zu kopieren.<br />
– BonusMalusSystem: Malus/Bonusentrichtung<br />
bei Überschreitung/Unterschreitung<br />
eines geschätzten Werts um<br />
30 Prozent oder mehr unter Berücksichtigung<br />
des Effizienzgrads.<br />
Die bernische Reform kombiniert das<br />
Benchmarking und das BonusMalus<br />
System. Pellegrini regte in ihrem Referat<br />
an, beim BenchmarkingSystem die Qualität<br />
der verwendeten Messverfahren zu<br />
überprüfen, kleineren Gemeinden flankierende<br />
Massnahmen anzubieten und den<br />
BonusMalus abzustufen.<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> und Ökonomie:<br />
ein Widerspruch?<br />
Prof. Pascal Engler, Dozent am Fachbereich<br />
<strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong>, behandelte das<br />
Thema «Ökonomisierung <strong>Soziale</strong>r <strong>Arbeit</strong>»<br />
und ging dabei von folgender Ausgangslage<br />
aus:<br />
– Infolge knapper Ressourcen muss <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> die ökonomische Perspektive<br />
im Sinne wirksamer und zielgerichteter<br />
Massnahmen mitdenken.<br />
– <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> kann effizienter werden.<br />
– Bei der Lösung sozialer Probleme<br />
besteht eine gegenseitige Abhängigkeit<br />
zwischen Politik und <strong>Soziale</strong>r <strong>Arbeit</strong>.<br />
Engler sieht das politische System als<br />
abhängig von der Problemlösungskompetenz<br />
der <strong>Soziale</strong>n <strong>Arbeit</strong>, da soziale Probleme<br />
Legitimationsdruck erzeugen. <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Arbeit</strong> erhalte so die Chance als Partnerin<br />
aufzutreten. Da sie bisher nicht ausgewiesen<br />
habe, was sie qualitativ und quantitativ<br />
leisten könne, drohe ihr Fremdbestimmung.<br />
Aus Sicht der <strong>Soziale</strong>n <strong>Arbeit</strong> ist<br />
gemäss Engler eine geeignete theoretische<br />
Fundierung von Effizienz (haben wir es<br />
«richtig» getan?) und Effektivität (haben wir<br />
«das Richtige» getan?) hängig. Werde<br />
effizient gleichgesetzt mit kostengünstig,<br />
könne die <strong>Soziale</strong> <strong>Arbeit</strong> nicht mehr «das<br />
Richtige» tun und verliere ihre Legitimationsbasis.<br />
Engler empfiehlt ein nachhaltiges<br />
Problemlösungskonzept, welches<br />
unter Einbezug von Wirtschaft, Umwelt<br />
und <strong>Soziale</strong>m eine multiprofessionelle,<br />
interdis ziplinäre Kooperation vorsieht. Bei<br />
Verwendung eines Ökonomiebegriffs,<br />
der das <strong>Soziale</strong> mit einbezieht, biete die<br />
Ökonomisierung der <strong>Soziale</strong>n <strong>Arbeit</strong> mehr<br />
Chancen als Risiken. Fraglich sei, ob die<br />
aktuellen Vernehmlassungsmodelle diese<br />
Nachhaltigkeit beachten.<br />
Aus der Podiumsdiskussion<br />
An der Diskussionsrunde würdigten alle<br />
Teilnehmenden die vorgeschlagenen kantonalen<br />
Massnahmen aus ihrer Sicht. Unter<br />
der Leitung von Prof. Daniel Iseli, Dozent<br />
und Projektleiter am Fachbereich <strong>Soziale</strong><br />
<strong>Arbeit</strong>, wirkten folgende Personen in der<br />
Diskussionsrunde mit:<br />
– Daniel Bichsel, Finanzverwalter Gemeinde<br />
Zollikofen, Vizepräsident Verband<br />
Bernisches Gemeindekader BGK<br />
– Andrea Lüthi, Geschäftsleiterin <strong>Berner</strong><br />
Konferenz für Sozialhilfe und Vormundschaft<br />
BKSV, Grossrätin SP<br />
– Blaise Kropf, Gewerkschaftssekretär<br />
vpod, Präsident Grüne Kanton Bern,<br />
Grossrat<br />
– André Gattlen, stellvertretender Vorsteher<br />
des Sozialamtes des Kantons Bern<br />
Das Publikum erhielt anschliessend Gelegenheit,<br />
Fragen zu stellen und die eigene<br />
Meinung einzubringen. Das BonusMalus<br />
System, dessen Chance auf eine Mehrheit<br />
im Grossen Rat intakt scheint, fand mehr<br />
befürwortende Stimmen als das ebenfalls<br />
diskutierte Selbstbehaltsmodell. Es war<br />
aber spürbar, dass etliche Anwesende<br />
Bedenken hegen und Optimierungsbedarf<br />
sehen.<br />
Stimmen zur Veranstaltung<br />
«Obwohl für mich der BonusMalus das<br />
kleinere Übel ist, bin ich kritisch, weil<br />
ein nachhaltiger Mitteleinsatz wichtiger<br />
sein sollte als die Frage, wie viel Geld wir<br />
ausgeben.»<br />
Liliane Zurflüh<br />
Leiterin regionaler Sozialdienst Erlach<br />
«Ich sehe auch viele Gefahren im Bonus<br />
MalusSystem, weil es Mitarbeitende unter<br />
Druck setzen kann.»<br />
Katharina eichelberger<br />
Sozialamt Langenthal<br />
«Das BonusMalusSystem scheint ein<br />
gangbarer Weg und eine gute Diskussionsgrundlage<br />
für weitere Optimierungen zu<br />
sein.»<br />
Beatrice reusser<br />
Leiterin Abteilung <strong>Soziale</strong>s Biel und Vizepräsidentin der<br />
<strong>Berner</strong> Konferenz für Sozialhilfe und Vormundschaft<br />
«Ich bin froh, dass das vorgeschlagene<br />
Anreizsystem Bewährtes – Solidarität im<br />
Lastenausgleich – nicht in Frage stellt.»<br />
Andreas Diggelmann<br />
Leiter Sozialdirektion Burgdorf<br />
<strong>impuls</strong> September 2010<br />
11