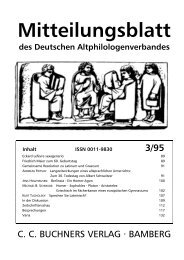Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die Projektion heutigen Wissens auf die Zukunft,<br />
wie sie z. B. im Delphi-Report zum Programm<br />
erhoben wird, macht einem unwillkürlich<br />
die Problematik aller zukunftsorientierten<br />
Wissenschaften bewußt, die, wie wir sehen,<br />
gerade in unserem Jahrhundert immer akuter<br />
geworden ist: die Macht und Riskantheit<br />
menschlichen Wissens. Die Formel ‚Wissen ist<br />
Macht’ (scientia est potentia), mit der vor etwa<br />
400 Jahren der Engländer Francis Bacon dem<br />
einerseits von Kopernikus und Galilei freigesetzten,<br />
andererseits von Descartes philosophisch<br />
legitimierten Forschungsdrang in Richtung<br />
Natur eine ungeheure, bis heute nicht gebrochene<br />
Dynamik verlieh, hat die bis dahin<br />
eine Einheit bildende Kultur der Menschen, also<br />
ihr Bemühen, die Welt entsprechend ihren Bedürfnissen<br />
zu gestalten, in zwei Teile zerrissen.<br />
Man spricht deshalb von den „Zwei Kulturen“,<br />
in denen man sich mit jeweils verschiedenen<br />
Ambitionen wissenschaftlich betätigt, von den<br />
Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften.<br />
Die einen sind, so die verbreitete Meinung,<br />
für die Zukunft zuständig, sie sind fortschrittsorientiert<br />
und, wie schon Bacon sagte,<br />
auf Praxis bezogen, mit wenig Sinn für das Vergangene,<br />
die anderen hängen an der Vergangenheit,<br />
ihre Vertreter stehen mit dem Rücken zur<br />
Zukunft, sie sind für die Bewältigung von Zukunftsaufgaben,<br />
da sie, wie Bacon ihnen vorwirft,<br />
„bei den Musen bleiben“, nutzlos und<br />
ineffektiv. Zwischen Zukunft und Herkunft<br />
klafft ein starker Riß. Und dieser Riß zieht sich<br />
durch die Universitätsdisziplinen nicht weniger<br />
als durch die Schulfächer, mit der Folge gegenseitiger<br />
Ignoranz und zuweilen gar kalter Abneigung<br />
voreinander.<br />
Allerdings hat sich, wie die wissenschaftliche<br />
Diskussion zeigt, der Trend längst zu wenden<br />
begonnen. Der Anstoß dazu ging erstaunlicherweise<br />
von der Naturwissenschaft aus. Ihr<br />
Forschen ist, wie es scheint, an Grenzen gestoßen,<br />
so daß ihre Erkenntnisobjekte in den Sog<br />
der ‚letzten Fragen’ des Menschen geraten<br />
sind. An diesen Grenzen schwindet der Gegensatz<br />
von Geist und Natur. „Der Geist kehrt<br />
zurück zur Natur“, so lapidar drückt es der<br />
Medizin-Nobelpreisträger von 1972, Gerald<br />
56<br />
M. Edelman, in seinem 1992 erschienenen<br />
Buch „Göttliche Luft, vernichtendes Feuer“ aus.<br />
In bewußter Abkehr von Galilei und Descartes<br />
schafft der amerikanische Forscher eine, wie die<br />
Kritik schreibt, „brillante und fesselnde neue<br />
Vision des menschlichen Geistes“, indem er von<br />
den Naturwissenschaften, vor allem der Biologie<br />
her versucht, dem auf die Spur zu kommen,<br />
was den Menschen zum Menschen macht, seinem<br />
Bewußtsein, seinem Denkvermögen.<br />
Edelmans Erkenntnisse sind revolutionierend<br />
und zugleich beruhigend. Er, der für die Entstehung<br />
des Geistes im Gehirn eine wissenschaftlich<br />
plausible Erklärung vorlegt, weist dem<br />
Menschen eine im Laufe der Evolution zugewachsene<br />
Form „des höheren Bewußtseins“ zu;<br />
und dieses sei bestimmt von Intentionalität, von<br />
Selbstheit, von Sprache, von Logik, von Wertempfinden,<br />
von einem Gespür für Zeit, also für<br />
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von der<br />
subjektiven Erfahrung von Welt und Geschichte,<br />
schließlich von Sinnhaftigkeit.<br />
Da aber dieses Denken über das Denken, das<br />
Forschen des Geistes über den Geist den Naturwissenschaftler<br />
ständig seine Abhängigkeit von<br />
der eigenen Subjektivität spüren, also die individuelle<br />
Begrenztheit seines Erkenntnisvermögens<br />
erfahren läßt - Edelman spricht geradezu<br />
von einem „Eingekerkertsein“ -, erweist sich für<br />
ihn die rein naturwissenschaftliche Erklärung<br />
des Menschen als eines Geistwesens, auch wenn<br />
sie zuverlässige, unverzichtbare Grundlagen des<br />
Wissens darüber liefert, letztlich als nicht ausreichend.<br />
Andere Wissenschaften müssen, wie<br />
Edelman selbst sagt, hinzukommen: die Psychologie,<br />
die Linguistik, die Philosophie, die<br />
Kulturwissenschaften, auch die Theologie.<br />
Wir sehen: Die Geisteswissenschaften sind hier<br />
gefordert, freilich in einer ganz neuen, bisherige<br />
Traditionen sprengenden Form. Man ist, wie es<br />
der amerikanische Forscher ausdrückt, „auf der<br />
Suche nach neuen Harmonien“. Sind solche<br />
Harmonien aber möglich? Baut man von der<br />
anderen Seite her, der geisteswissenschaftlichen,<br />
an der noch offensichtlich nötigen Brücke über<br />
den Jahrhunderte alten Graben mit? Edelman