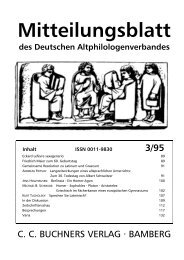Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
seiner Geistbefähigung bald den guten, bald den<br />
schlechten Weg“, anschließt, schreibt er dem<br />
Wissen selbst eine ethische Bedeutsamkeit zu,<br />
so daß es der kritischen Vernunft unterworfen<br />
wird. Es geht ihm nicht so sehr um das Wunder<br />
des Menschen als Geistwesen im einzelnen,<br />
sondern um die Wirkung dieser Begabung für<br />
das Ganze der Menschheit, er achtet darauf,<br />
„wie sich das Ungeheure menschlichen Tuns“<br />
auf die ihn umgebende Welt, auf die Natur auswirkt.<br />
Jonas thematisiert die geistbedingte Sonderstellung<br />
des Menschen über die Natur, so daß<br />
er sich nun unmittelbar mit den Naturwissenschaften<br />
auseinandersetzen muß.<br />
Der Mensch wird nicht mehr nur in seiner<br />
Selbstwerdung betrachtet und beurteilt, er wird<br />
in seiner Verantwortlichkeit für das Werden und<br />
Leben nachfolgender Generationen gesehen.<br />
Damit gewinnt für ihn das Nachdenken des<br />
Menschen über sein Denken, seinen Geist und<br />
über das Verhältnis von Geist und Natur eine<br />
zutiefst ethische Dimension, die weit über die<br />
Zuständigkeit des Naturwissenschaftlers hinausreicht.<br />
„Die Naturwissenschaft sagt“ - nach Jonas’<br />
Meinung - „nicht die ganze Wahrheit über<br />
die Natur aus.“ Die Frage, ob die Natur, ob die<br />
Schöpfung zu bewahren sei, so daß spätere Generationen<br />
darin noch leben können, daß also<br />
der neue kategorische Imperativ: „Handle so,<br />
daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich<br />
sind mit der Permanenz echten menschlichen<br />
Lebens auf Erden“, ist nicht mit naturwissenschaftlichen<br />
Argumenten zu beantworten, sie<br />
fordert letztlich nach Jonas eine metaphysisch,<br />
also religiös begründete Antwort. Vielleicht<br />
liege nur darin ein verpflichtender Sinn, das<br />
Leben auf Erden zu erhalten, daß der Mensch<br />
sich als etwas Heiliges begreift, also sozusagen<br />
in einem Axiom.<br />
Homo homini res sacra. Es ließe sich dann fragen,<br />
ob etwa Senecas Maxime, daß der Mensch<br />
dem Menschen etwas Heiliges sei, den Kernsatz<br />
einer Zukunftsethik ausmache, eine Verpflichtung<br />
zur Rücksicht ausdrücke an die jeweils<br />
jetzige gegenüber der kommenden Generation.<br />
Hans Jonas freilich denkt anders. Für ihn verlangt<br />
die Zukunftgerichtetheit menschlicher<br />
Verantwortung eine ganz neuartige Ethik: kein<br />
58<br />
Prinzip früherer Ethik sei diesem neuen Anspruch<br />
an den Menschen gewachsen. Und doch<br />
läßt sich - Jonas würde dem gewiß nicht widersprechen<br />
- der Boden im Gewissen des Menschen<br />
für ethische Entscheidungen, für Moral<br />
nur auflockern durch die Auseinandersetzung<br />
mit Mustern und Modellen von Ethik, wie sie<br />
uns seit alters die Menschheitsgeschichte zur<br />
Verfügung stellt. Jonas selbst orientiert sich ja<br />
laufend an herkömmlichen Leitbildern.<br />
Der Naturwissenschaftler Edelman und der Geisteswissenschaftler<br />
Jonas kommen sich also<br />
dort, wo sie die Grenzen markieren, sehr nahe;<br />
sie sehen sich offensichtlich aufeinander angewiesen.<br />
Die Brücke, die wir hier zwischen den<br />
beiden hergestellt haben, ist nicht künstlich konstruiert;<br />
solche Begegnungen über den Graben<br />
hinweg finden heute immer mehr, auf verschiedenen<br />
Ebenen und unmittelbar, statt. Nur ein<br />
Beweis dafür: In ein und demselben Buch „Gott<br />
und die Wissenschaft“ (Paris 1990) diskutieren<br />
der Philosoph und Theologe Jean Guitton und<br />
die Physiker Igor und Grichke Bogdanow an<br />
den Grenzen physikalischer Erkenntnis über die<br />
‚letzten Fragen’ des Menschen, mit der vielleicht<br />
tröstlichen Einsicht, daß Physik und Metaphysik,<br />
Fakten und Ideen, Materie und Bewußtsein<br />
ein und dasselbe, also Ausformungen<br />
der einen Natur seien, daß also beide Betrachtungsweisen,<br />
die naturwissenschaftliche und die<br />
geisteswissenschaftliche, ihre Berechtigung<br />
haben. Das läßt den Schluß zu: die Selbstwerdung<br />
des Menschen, die sich stets von neuem<br />
vollzieht, bedarf allseitiger Unterstützung, von<br />
seiten des Fortschritts und von seiten der Tradition,<br />
also von der Biologie, der Physik, der<br />
Chemie, der Psychologie, aber auch der<br />
Sprachlehre, der Logik, von den Kulturwissenschaften,<br />
von der Philosophie, der Theologie<br />
und eben auch von der Ethik, und zwar immer<br />
im Erfahrungsraum von Welt und Geschichte.<br />
Wir sehen: die Zukunft braucht die Herkunft.<br />
Beides sind heute wieder kompatible Größen<br />
geworden.<br />
Der Satz „Zukunft braucht Herkunft“ ist also<br />
nicht bloß ein gern gehörter oder gelesener Slogan;<br />
er stellt eine anthropologische Wahrheit<br />
dar, die auch zu modernen wissenschaftlichen