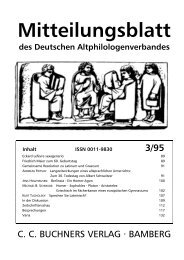Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Den Sonderweg Europas sieht Meier eindeutig<br />
bei den Griechen beginnen. Während alle frühen<br />
Völker durch monarchische Strukturen und<br />
Zentren geprägt sind, ist diese Erscheinung bei<br />
den Griechen die Ausnahme oder nur Vorform<br />
für die charakteristische Polis-Gesellschaft, in<br />
der die Bürgerschaft ihre Affekte kontrolliert,<br />
mitdenkt und durch Herstellung von Konsens<br />
ohne monarchische Führung das Staatswesen<br />
aufzubauen sich bemüht. Notwendige Folge ist<br />
das Entstehen von Verantwortung der Bürger<br />
für die politische Ordnung, in der der Bürgerschaft<br />
als politische Kraft durch permanentes<br />
Ändern der politischen Zustände bald<br />
‚Verfassungsdenken’ nicht mehr fremd ist. Die<br />
politische Praxis wird abgestützt durch das philosophische<br />
Nachdenken über das Wesen und<br />
Funktionieren der Ordnung. Das Gemeinwesen<br />
ist die Bürgerschaft, deren Mitglieder als Individuen<br />
zwar nach Autarkie streben, in der aber<br />
der einzelne integrativer Teil eines Ganzen<br />
bleibt. Jeder Bürger ist betroffen, gefragt und<br />
verantwortlich (horizontale Solidarität), alle<br />
sind herausgefordert. Die griechische Philosophie<br />
wie auch die Tragödie legen die grundsätzlichen<br />
Fragen offen: das Wesen des Menschen,<br />
mit seinen Fähigkeiten und seinen Möglichkeiten<br />
im Positiven und Negativen. Griechisch und<br />
damit europäisch ist es nach Meiers Überzeugung,<br />
sich den Schwierigkeiten jeweils zu stellen,<br />
mit Rationalität nach Lösungen zu suchen,<br />
um sich in der Welt selbstbewußt zu behaupten,<br />
nach Gerechtigkeit unablässig zu suchen, die<br />
Frage nach dem Sinn immer wieder zu stellen<br />
und damit Kultur zu schaffen.<br />
Der Zuhörer, der den nachdenklichen, weisen<br />
Einsichten des Vortragenden folgte, brauchte<br />
die Frage nach dem Sinn und der Notwenigkeit<br />
des Griechischunterrichtes am Ende nicht mehr<br />
zu stellen.<br />
2.2 Sprache ohne Welt ist nicht vermittelbar.<br />
Die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit,<br />
die sich in den Denkmälern der Hauptstadt<br />
des Imperium Romanum vornehmlich manifestiert,<br />
war Gegenstand eines sehr anregenden<br />
Vortrags von Dr. FRANZ PETER WAIBLINGER<br />
(Universität München) zum Thema: „Urbs aeterna.<br />
Die Stadt Rom im Lateinunterricht“. Er<br />
78<br />
ging von der widersprüchlichen Situation aus,<br />
daß das Interesse an der römischen Kultur außerhalb<br />
der Schule ganz erstaunlich sei, Motive<br />
würden sogar durch die moderne Produktwerbung<br />
aufgegriffen, während in der Schulpraxis<br />
immer noch Materialien weitgehend fehlen und<br />
auch didaktische Konzepte kaum sichtbar sind.<br />
Ziel der unterrichtlichen Behandlung ist nicht<br />
die Förderung archäologischer Kenntnisse, sondern<br />
die Einsicht, daß das Vergangene im Gegenwärtigen<br />
enthalten ist: die Gegenwärtigkeit<br />
der Geschichte, die Kontinuität der Tradition.<br />
Gerade die Stadt Rom bietet ein ideales anschauliches<br />
Modell für urbanes Leben im Fortleben<br />
der antiken Stadt. Dadurch kann nach<br />
Waiblingers Ansicht der Lateinunterricht einen<br />
wertvollen Beitrag leisten für interkulturelles<br />
Lernen und für das bessere Verständnis der Krise<br />
der modernen Städte. Er zeigte überzeugend<br />
an Hand von Abbildungen aber auch Texten in<br />
vier Aspekten die Stadt Rom als Modell für<br />
urbane Strukturen.<br />
Deutlich wurden zunächst die Probleme des<br />
Großstadtverkehrs am antiken Rom entwickelt,<br />
die bis heute unvermindert anhalten. Aufschlußreich<br />
war auch Caesars Versuch, durch die Lex<br />
Iulia municipalis Rom tagsüber in eine Fußgängerzone<br />
zu verwandeln, eine rigorose Verfügung,<br />
die heute politisch nicht mehr durchsetzbar<br />
wäre. Welche Gefährdung vom Großstadtverkehr<br />
schon zur Kaiserzeit ausging, zeigt Juvenal<br />
in einer Satire. Mit Hilfe einer Reihe von<br />
Texten konnte der Referent nachweisen, wie<br />
sich nach gravierenden Veränderungen im Mittelalter<br />
(verkehrsbehindernde Bauten), in der<br />
Renaissance (Verbindung der Pilgerkirchen),<br />
durch Nationalstaatbildung (Nationaldenkmal)<br />
und Faschismus (Aufmarschstraßen) heute in<br />
der modernen Konzeption wieder das antike<br />
Konzept des radialen Straßensystems ablesen<br />
läßt.<br />
Als zweiter Aspekt wurde das Infrastrukturproblem<br />
der Wasserversorgung einer Großstadt<br />
vorgestellt. Die Einzigartigkeit dieser römischen<br />
Leistung erwähnt bereits ein Text des Plinius<br />
voller Stolz, den praktischen Nutzen machen die<br />
Ausführungen von Frontinus deutlich, Cassio-