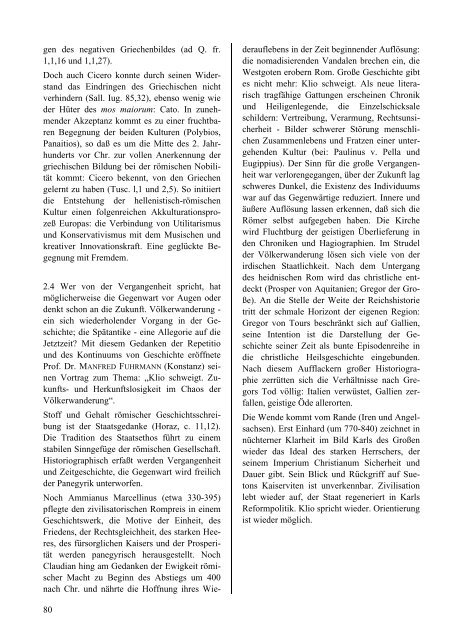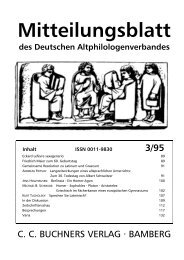Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Mitteilungsblatt - Deutscher Altphilologenverband
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
gen des negativen Griechenbildes (ad Q. fr.<br />
1,1,16 und 1,1,27).<br />
Doch auch Cicero konnte durch seinen Widerstand<br />
das Eindringen des Griechischen nicht<br />
verhindern (Sall. Iug. 85,32), ebenso wenig wie<br />
der Hüter des mos maiorum: Cato. In zunehmender<br />
Akzeptanz kommt es zu einer fruchtbaren<br />
Begegnung der beiden Kulturen (Polybios,<br />
Panaitios), so daß es um die Mitte des 2. Jahrhunderts<br />
vor Chr. zur vollen Anerkennung der<br />
griechischen Bildung bei der römischen Nobilität<br />
kommt: Cicero bekennt, von den Griechen<br />
gelernt zu haben (Tusc. l,1 und 2,5). So initiiert<br />
die Entstehung der hellenistisch-römischen<br />
Kultur einen folgenreichen Akkulturationsprozeß<br />
Europas: die Verbindung von Utilitarismus<br />
und Konservativismus mit dem Musischen und<br />
kreativer Innovationskraft. Eine geglückte Begegnung<br />
mit Fremdem.<br />
2.4 Wer von der Vergangenheit spricht, hat<br />
möglicherweise die Gegenwart vor Augen oder<br />
denkt schon an die Zukunft. Völkerwanderung -<br />
ein sich wiederholender Vorgang in der Geschichte;<br />
die Spätantike - eine Allegorie auf die<br />
Jetztzeit? Mit diesem Gedanken der Repetitio<br />
und des Kontinuums von Geschichte eröffnete<br />
Prof. Dr. MANFRED FUHRMANN (Konstanz) seinen<br />
Vortrag zum Thema: „Klio schweigt. Zukunfts-<br />
und Herkunftslosigkeit im Chaos der<br />
Völkerwanderung“.<br />
Stoff und Gehalt römischer Geschichtsschreibung<br />
ist der Staatsgedanke (Horaz, c. 11,12).<br />
Die Tradition des Staatsethos führt zu einem<br />
stabilen Sinngefüge der römischen Gesellschaft.<br />
Historiographisch erfaßt werden Vergangenheit<br />
und Zeitgeschichte, die Gegenwart wird freilich<br />
der Panegyrik unterworfen.<br />
Noch Ammianus Marcellinus (etwa 330-395)<br />
pflegte den zivilisatorischen Rompreis in einem<br />
Geschichtswerk, die Motive der Einheit, des<br />
Friedens, der Rechtsgleichheit, des starken Heeres,<br />
des fürsorglichen Kaisers und der Prosperität<br />
werden panegyrisch herausgestellt. Noch<br />
Claudian hing am Gedanken der Ewigkeit römischer<br />
Macht zu Beginn des Abstiegs um 400<br />
nach Chr. und nährte die Hoffnung ihres Wie-<br />
80<br />
derauflebens in der Zeit beginnender Auflösung:<br />
die nomadisierenden Vandalen brechen ein, die<br />
Westgoten erobern Rom. Große Geschichte gibt<br />
es nicht mehr: Klio schweigt. Als neue literarisch<br />
tragfähige Gattungen erscheinen Chronik<br />
und Heiligenlegende, die Einzelschicksale<br />
schildern: Vertreibung, Verarmung, Rechtsunsicherheit<br />
- Bilder schwerer Störung menschlichen<br />
Zusammenlebens und Fratzen einer untergehenden<br />
Kultur (bei: Paulinus v. Pella und<br />
Eugippius). Der Sinn für die große Vergangenheit<br />
war verlorengegangen, über der Zukunft lag<br />
schweres Dunkel, die Existenz des Individuums<br />
war auf das Gegenwärtige reduziert. Innere und<br />
äußere Auflösung lassen erkennen, daß sich die<br />
Römer selbst aufgegeben haben. Die Kirche<br />
wird Fluchtburg der geistigen Überlieferung in<br />
den Chroniken und Hagiographien. Im Strudel<br />
der Völkerwanderung lösen sich viele von der<br />
irdischen Staatlichkeit. Nach dem Untergang<br />
des heidnischen Rom wird das christliche entdeckt<br />
(Prosper von Aquitanien; Gregor der Große).<br />
An die Stelle der Weite der Reichshistorie<br />
tritt der schmale Horizont der eigenen Region:<br />
Gregor von Tours beschränkt sich auf Gallien,<br />
seine Intention ist die Darstellung der Geschichte<br />
seiner Zeit als bunte Episodenreihe in<br />
die christliche Heilsgeschichte eingebunden.<br />
Nach diesem Aufflackern großer Historiographie<br />
zerrütten sich die Verhältnisse nach Gregors<br />
Tod völlig: Italien verwüstet, Gallien zerfallen,<br />
geistige Öde allerorten.<br />
Die Wende kommt vom Rande (Iren und Angelsachsen).<br />
Erst Einhard (um 770-840) zeichnet in<br />
nüchterner Klarheit im Bild Karls des Großen<br />
wieder das Ideal des starken Herrschers, der<br />
seinem Imperium Christianum Sicherheit und<br />
Dauer gibt. Sein Blick und Rückgriff auf Suetons<br />
Kaiserviten ist unverkennbar. Zivilisation<br />
lebt wieder auf, der Staat regeneriert in Karls<br />
Reformpolitik. Klio spricht wieder. Orientierung<br />
ist wieder möglich.