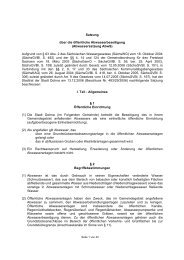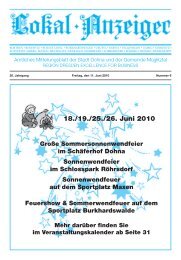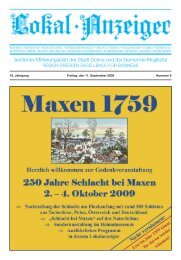Endlich ist es so weit, unser neues ... - Stadt Dohna
Endlich ist es so weit, unser neues ... - Stadt Dohna
Endlich ist es so weit, unser neues ... - Stadt Dohna
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Nummer 8 Lokalanzeiger der <strong>Stadt</strong> <strong>Dohna</strong> und der Gemeinde Müglitztal<br />
Seite 26<br />
Äußerlich hielten di<strong>es</strong>e Me<strong>ist</strong>er schon wie jetzt eine Innung zusammen.<br />
Sie hielten ihre Sitzungen unter Beisein ein<strong>es</strong> Gerichtsverwandten<br />
(Schöffen) namens George Köhler. Ihr Gewerbe scheint geblüht zu<br />
haben, denn sie konnten mehrere G<strong>es</strong>ellen b<strong>es</strong>chäftigen. Der erste<br />
Lehrling, Hans Jakob Rothläthliche aus Dr<strong>es</strong>den, wird am Tage Bartholomey<br />
1657 laut Protokoll „Vor den dahmahl gew<strong>es</strong>senen Me<strong>ist</strong>er<br />
Und G<strong>es</strong>ellen in <strong>Dohna</strong> in beysein, H. George Köhlers Gerichts<br />
Verwanter bey Me<strong>ist</strong>er Hans George Rickert das Handwerck zu lehren<br />
Auff 5 Jahr auffgedinget.“<br />
So sind denn die ersten Me<strong>ist</strong>er di<strong>es</strong><strong>es</strong> Gewerb<strong>es</strong> aus der nächsten<br />
Nähe, aus dem äußersten Osten und Süden der damals deutschen<br />
Gaue hier zusammengekommen als die Begründer der <strong>Dohna</strong>er Posamenten-Industrie,<br />
waren in der Lage, g<strong>es</strong>ellen und Lehrlinge zu<br />
b<strong>es</strong>chäftigen und fanden Absatz für ihre Waaren. So war denn auch<br />
die Veranlassung vorhanden, sich zu einer Innung zu fügen und vom<br />
Kurfürsten b<strong>es</strong>ondere Privilegien zu erbitten.<br />
1) Di<strong>es</strong><strong>es</strong> Gewerbe hatte schon vorher hier b<strong>es</strong>tanden und mind<strong>es</strong>tens<br />
einen Vertreter gehabt. Nach Ausweis der <strong>Dohna</strong>er Taufreg<strong>ist</strong>er<br />
ließ am 24. Dezember 1630 ein „Bortenwirker“ Zeibig (? Name undeutlich)<br />
ein Kind taufen. Er wird aber, was <strong>so</strong>nst bei Handwerksme<strong>ist</strong>ern<br />
nur versäumt wird, als Me<strong>ist</strong>er bezeichnet. Auch in dem 1647 beginnenden<br />
Me<strong>ist</strong>er……. Kommt er nicht vor. Vielleicht hat er zu den<br />
<strong>so</strong>gen. „Pfuschern“ gehört. (S. Sta 2, Nr.3.)<br />
2. Wie die Posamentierinnung ihre Privilegien erhielt.<br />
Di<strong>es</strong>e Privilegien sind ihnen am 22.Juni 1666 von Kurfürst Joh. Georg<br />
verliehen worden (gegenzeichnet von v.Lüttichau). Di<strong>es</strong>elben enthalten<br />
22 Artikel, die in ihrer Fassung von denen der Erzgeb. Posamentierinnungen<br />
(s. Edwin Siegel: Zur G<strong>es</strong>ch.d<strong>es</strong> Posamentiergewerb<strong>es</strong>)<br />
ganz w<strong>es</strong>entlich abweichen. Di<strong>es</strong>e Artikel waren bereits am 13.<br />
Aug.1662 eingereicht worden und <strong>so</strong>llten nicht allein für <strong>Dohna</strong> maßgebend<br />
sein, <strong>so</strong>ndern zugleich für die Amtsstädtlein Königstein und<br />
Berggießhübel. Freilich finden wir unter den im Laufe der Zeit der<br />
Innung angehörigen 105 Me<strong>ist</strong>ern nur 3, die in Königstein wohnten<br />
und nicht einen einzigen von Berggießhübel. Die nöthigen Erkundigungen<br />
hatte die kurfürstliche Regierung durch den gew<strong>es</strong>enen Amtsschöffer<br />
Zacharias Cotte eingezogen. Di<strong>es</strong>er <strong>ist</strong> den Posamentierern<br />
jedenfalls bei der Aufstellung ihrer Artikel behilflich gew<strong>es</strong>en. Die Posamentierer<br />
werden ausdrücklich „ Bortenwickler“ genannt. Aus den Privilegien<br />
selbst und den Quartalsprotokollen <strong>ist</strong> nun zu ersehen, wie<br />
die entstandene Innung ihr Gewerbe ausgeübt hat.<br />
3. Was für Waaren fertigten die Posamentierer?<br />
Sie wahren sich nämlich wie andere Innungen (f. Siegel a. a. D) vor<br />
den Pfuschern, die allerlei Waaren fertigen, verkaufen und Hausiren,<br />
im 14 Artikel:“Soll sich niemand unterstehen, welche in di<strong>es</strong><strong>es</strong> Handwerk<br />
nicht gehören und demselben sich gemäß bezeigen weder mit<br />
Schutzspulen noch Platschutzen hohen oder niederkämmen und Lützen<br />
zu arbeiten pp.“ Es <strong>ist</strong> von hohem Inter<strong>es</strong>se, daß uns hier ausführlicher<br />
wie in allen uns vorliegenden Ordnungen d<strong>es</strong> Erzgebirg<strong>es</strong>,<br />
selbst der Nürnberger und Hamburger Artikel, die Handwerksgeräthe<br />
der Posamentierer genannt werden, deren Gebrauch sie den Zunftgenossen<br />
vorbehalten wollen. Man muß sich nämlich vergegenwärtigen,<br />
daß das Bortenwirken auf einfachen Geräthen, wie der Bortenlade<br />
(dem kleinen Häcken der Annaberger), eine Lieblingständelei<br />
der Frauen d<strong>es</strong> späteren Mittelalters war, wie etwa das Häkeln und<br />
Sticken heutzutage. Verarmte Frauen und Mädchen mögen wohl gar<br />
als Concurrenz der ehrsamen Posamentierzunft sich mißliebig gemacht<br />
haben. Aller di<strong>es</strong>er Pfuscharbeit <strong>so</strong>ll der Boden unter den Füßen<br />
genommen werden. Selbst die Vorarbeiten d<strong>es</strong> Posamentierers, wie<br />
das Aufspulen d<strong>es</strong> Schußfadens für den Schützen, <strong>so</strong>llten nur in der<br />
zünftigen Werkstatt geübt werden dürfen, all<strong>es</strong> Arbeiten mit Schutzspulen<br />
d.i. Schützspulen wird daher verboten. Auch die einfachste<br />
Wirkerei von Bändern und Borten ohne D<strong>es</strong>sins, wie sie leicht ohne<br />
b<strong>es</strong>ondere Kunstfertigkeit auf der einfachen Bortenlade herg<strong>es</strong>tellt<br />
wurden, die hier „Platschutzen“ genannt wird, weil in der Kette oder<br />
dem Schweif nur mit dem hölzernen Blatt oder Riet zugleich das Fach<br />
gebildet und der Schußfaden angedrückt wurde, der mit dem Schützen<br />
hindurchgeworfen wurde, wird verboten. Daraus sehen wir, daß<br />
in <strong>Dohna</strong> zunächst viel einfache Borten und Bänder ohne alle D<strong>es</strong>sins<br />
bereitet wurden.<br />
In gleicher Weise werden aber auch die Hohen- und Niederkämme<br />
erwähnt mit den Litzen.<br />
Die Niederkämme können nur einfache Handstühle, fast identisch<br />
mit dem Webstuhle sein, auf denen ebenfalls keine kunstvollen Muster<br />
herg<strong>es</strong>tellt werden konnten. Da nun aber die Hochkämme, mit<br />
denen bis zu 24 Schuß herg<strong>es</strong>tellt werden können, und außerdem<br />
die Lützen genannt werden, <strong>so</strong> bekommt man schon etwas mehr<br />
Achtung vor den Me<strong>ist</strong>ern der drei Städtlein. Die Lützen sind offenbar<br />
keine Waaren, <strong>so</strong>ndern die bekannten Halter der maillons im<br />
vervollkommneten Handstuhle, durch welche die einzelnen Kettenfäden<br />
g<strong>es</strong>ondert und zum Heben durch die mit Tritten in Verbindung<br />
gebrachten Hochkämme bereit gehalten werden. Auf di<strong>es</strong>en Stühlen<br />
können die kunstvollen Muster ausgeführt werden. Wenn wir<br />
allerdings die in der Lade befindliche kleine Patroniertafel vom Jahre<br />
1676, die uns vorliegt, betrachten, <strong>so</strong> kommen wir zu dem Schlusse,<br />
daß die in <strong>Dohna</strong> gefertigten Muster nicht allzu complicirt gew<strong>es</strong>en<br />
sein mögen. B<strong>es</strong>agter „Schieferstein“, wie ihn die Acten nennen,<br />
<strong>ist</strong> nämlich 19,5 cm lang, 12,8 cm breit und in 82 x 55 Quarr<strong>es</strong><br />
eingetheilt. Er trägt auf der einen Seite die Jahr<strong>es</strong>zahl 1676, und<br />
auf der anderen 16. H. A. W. 78 und die Inschrift: Ulrich Rost hat<br />
mich gemacht. Aus alledem kann man zu dem Schluisse gelangen,<br />
daß im Anfange nur die gewöhnliche Marktwaare gefertigt wurde,<br />
wie sie auf den Jahrmärkten, die die Me<strong>ist</strong>er b<strong>es</strong>uchten, gern gekauft<br />
wurde. Dazu kommt, daß di<strong>es</strong>e Zeit gerade diejenige <strong>ist</strong>, in der den<br />
Band- und Bortenmachern das Leben durch die Concurrentz d<strong>es</strong><br />
ausländischen Mühlstuhl<strong>es</strong> <strong>so</strong> sauer gemacht wurde, daß alle Regierungen<br />
der deutschen Länder, selbst der Kaiser, mit b<strong>es</strong>onderen<br />
G<strong>es</strong>etzen dagegen einschriten mussten (s. Siegel a. a. D.). Was<br />
<strong>so</strong>nst noch auf B<strong>es</strong>tellung gefertigt worden <strong>ist</strong>, wird kaum <strong>weit</strong>er als<br />
bis Dr<strong>es</strong>den gebracht worden sein. Da die Innung sich fortwährend<br />
aus Orten aller Himmelsgegenden ergänzte, wie die <strong>so</strong>rgfältig geführte<br />
L<strong>ist</strong>e der Me<strong>ist</strong>er lehrt, mag manche neue Manier und manch<strong>es</strong><br />
neue Muster mitgekommen sein. Im letzen Jahrhundert ihr<strong>es</strong> B<strong>es</strong>tehens<br />
<strong>ist</strong> fast ausschließlich alle Art Chenille gefertigt worden. Noch<br />
in den sechziger Jahren di<strong>es</strong><strong>es</strong> Jahrhunderts sah man in verschiedenen<br />
Häusern <strong>Dohna</strong>s lange Zimmer, die als ehemalige Drehsäle<br />
zur Anfertigung der Chenille bezeichnet wurden.<br />
Außerdem bemächtigten sich die Posamentiere zum Theil einer neuen<br />
Industrie, welche zu Anfang d<strong>es</strong> 18.Jahrhundert in <strong>Dohna</strong> eingeführt<br />
wurde, der Strohflecht- und Strohhutnähindustrie. Mag Bartzsch berichtet<br />
in seiner „H<strong>ist</strong>orie der alten Burg und Städtgens <strong>Dohna</strong> 1733: „Sonderlich<br />
wissen die Weibsper<strong>so</strong>nen aus weißen Stroh, welche herum<br />
häufig zu haben, Strohhütte mancherlei Art zu machen, die nicht nur<br />
im Lande verführt und verhandelt werden.“ Möhring in „<strong>Dohna</strong>, <strong>Stadt</strong><br />
und Burg“ 1843 sagt:“ Ein deutscher Erwerbszweig, vorzüglich der<br />
ärmeren Klasse von Wichtigkeit, <strong>ist</strong> das aus den Halmen d<strong>es</strong> Weizenstroh<strong>es</strong><br />
bereitete Strohgeflecht, aus welchem Strohhüte in verschiedenen<br />
Formen gefertigt und ins Ausland nach Pommern, Mecklenburg,<br />
Weimar, Suhl, Schmalkalden bis in die Rheingegenden versendet<br />
werden. Der erste, welcher di<strong>es</strong>e Arbeit einführte, war Chr<strong>ist</strong>ian<br />
Gottlob Schubert. Er verheirathete sich 1726 mit der Tochter d<strong>es</strong><br />
Wagners Knittel, welcher einen kleinen Kramladen führte, wobei nun<br />
di<strong>es</strong>er Schwieger<strong>so</strong>hn das Strohflechtg<strong>es</strong>chäft anfing, kleine runde<br />
Hüte daraus fertigte und die Märkte in Pirna, Dr<strong>es</strong>den, Freiberg und<br />
alsdann die Leipziger M<strong>es</strong>se bezog.“<br />
Di<strong>es</strong>er Schubert war zwar kein Posamentier, <strong>so</strong>ndern ein Stellmacherg<strong>es</strong>elle,<br />
der seine Kunst aus dem Schwarzwalde mitbrachte.<br />
Auch wurde das Strohflechten in keine Posamentierwerkstatt eingeführt;<br />
di<strong>es</strong> übten Frauen und Kinder und das Nähen die Weiber.<br />
Wohl aber wurden die fertigen Hüte allerlei Posamenten gebraucht<br />
und außerdem nahmen die Posamentiere die Strohhüte mit auf M<strong>es</strong>sen<br />
und Märkte. Wir wissen b<strong>es</strong>timmt, daß der Posamentierme<strong>ist</strong>er<br />
Johann Gottlob Gäbel außer seinen Posamentierwaaren auch<br />
mit Strohhüten, die gerade er in großen Mengen anfertigen ließ, von<br />
1807 an die Leipziger M<strong>es</strong>se regelmäßig b<strong>es</strong>ucht hat. Freilich mag<br />
die Strohhut- und Strohgeflecht- Industrie nicht ganz ohne Schuld<br />
am Niedergange der Posamentier-Industrie gew<strong>es</strong>en sein. Gerade<br />
in der Mitte d<strong>es</strong> laufenden Jahrhunderts hörten nach und nach die<br />
Posamentiere auf, in gleichem Maße nahm das Verlegerthum für<br />
Strohgeflecht zu und in noch ungleich größerer Zahl thaten sich kleine<br />
Strohhut-G<strong>es</strong>chäfte auf, die freilich auch nach und nach wieder<br />
eingingen, wenn sie sich nicht zu Fabriken entwickeln konnten, wie