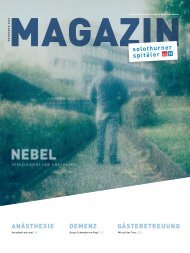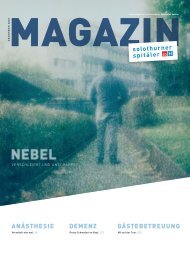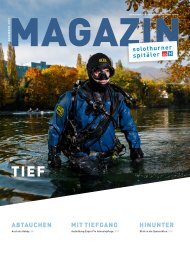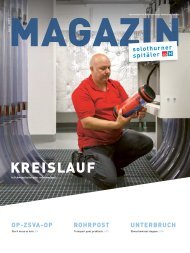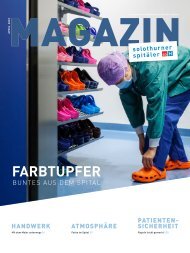Magazin Mitarbeitende Solothurner Spitäler 03/17 - Wiki, wiki
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FOKUS<br />
PFLEGE<br />
Der Vorbereitung wird grosse<br />
Aufmerksamkeit geschenkt.<br />
Damit alles parat ist, wenn es<br />
dann los geht.<br />
PSYCHIATRISCHE DIENSTE<br />
K R I S E N P L A N<br />
Krisen können sich anmelden oder unerwartet eintreffen. Doch wie bereiten sich Betroffene, Ärzte und<br />
Pflegepersonal auf psychosoziale Krisen vor?<br />
•••<br />
Phasen brauche es Empathie: «Ich erkläre geduldig,<br />
dass die Schwangerschaft nun schon viele Wochen<br />
dauere und die Geburt eben ganz, ganz nahe sei.»<br />
Es gibt sie auch, die hitzigen Momente. Die geburtshilflichen<br />
Notfälle. Dann pressiert es. Man funktioniert<br />
einfach nur noch. Zügig arbeiten. Der Hektik<br />
mög lichst wenig Spielraum geben. Eine andere ausserordentliche<br />
Situation ist, wenn alle Gebärsäle<br />
belegt sind und sich bereits weitere Schwangere<br />
angemeldet haben. «Gerade auch in diesen Momenten<br />
wollen wir in Ruhe arbeiten und die Bedürfnisse<br />
befriedigen.» Sich auf das Wichtigste fokussieren<br />
und Schritt für Schritt weiterarbeiten heisst dann die<br />
Devise. «Es bleibt schlicht keine Zeit, an Zeit zu denken.»<br />
Und dann ist plötzlich alles anders, das Kind ist da.<br />
Vom einen Moment auf den anderen beginnt eine<br />
neue Zeitrechnung. Der junge Erdenbewohner meldet<br />
von Anbeginn seine Bedürfnisse an. «Es ist halt<br />
so», schmunzelt Marina Gehriger, «dass das Kleinkind<br />
schon bald über die Familienzeit und den Rhythmus<br />
bestimmt.»<br />
Was machen Sie nach einem ereignisreichen,<br />
rasanten Arbeitstag?<br />
«Auf dem Sofa die Füsse hochhalten und alles etwas<br />
verlangsamen, das hilft.»<br />
Zum Schluss einen Zeitsprung zurück zur ersten Geburt.<br />
Seither ist nämlich etwas geblieben: «Ganz nah<br />
am grossen Ereignis vergesse ich Zeit, Tempo und<br />
Hektik noch heute. So wie beim ersten Mal. Dieses<br />
befreiende Gefühl tut einfach gut. Dies überträgt sich<br />
auf die Gebärende.»<br />
PSYCHOSOZIALE KRISEN können unvermittelt auftreten,<br />
zeichnen sich jedoch häufig bereits im Vorfeld<br />
ab. Wenn die Betroffenen einen plötzlichen Verlust<br />
des Bewältigungsvermögens in Bezug auf die aktuelle<br />
Lebenssituation erleben, kann ein stationärer Aufenthalt<br />
in einer psychiatrischen Klinik sinnvoll sein.<br />
Die Betroffenen werden darin unterstützt, die unmittelbare<br />
Krise aufzulösen. Um bestmöglich auf eine<br />
erneute Krise vorbereitet zu sein und das Risiko für<br />
deren Auftreten zu verringern, erstellen Betroffene,<br />
eine Assistenzärztin oder -arzt und Bezugspflegefachperson<br />
auf einigen Stationen der Psychiatrischen<br />
Dienste gemeinsam einen Krisenplan. Der Krisenplan<br />
ist ein systematisierter Bogen mit mehreren<br />
Fragen, die auf die Reflexion des eigenen Zustands<br />
ausgelegt ist. Durch diese Reflexion erfolgt eine Sensibilisierung<br />
für die patienteneigenen Ressourcen.<br />
Weiter werden individuelle Merkmale herausgearbeitet,<br />
die den Betroffenen und seinen Angehörigen<br />
helfen können, Frühwarnzeichen zu erkennen und so<br />
in Zukunft schneller zu bemerken, dass eine Krise<br />
nahen könnte. Anschliessend werden Massnahmen<br />
erarbeitet, die die Betroffenen selber vornehmen<br />
können, um vor oder während einer Krise wieder vermehrt<br />
Stabilität zu erlangen. Ergänzend erhalten die<br />
Betroffenen eine Visitenkarte, auf der sie das Wich<br />
tigste zur Krisenprävention in Kürze sowie die Telefonnummer<br />
einer Bezugsperson notieren können.<br />
Im Zentrum jeder Frage des Krisenplans steht die<br />
Sichtweise der Betroffenen. Die individuelle Beschreibung<br />
ihrer persönlichen Merkmale ersetzt –<br />
wenn möglich – die Fachsprache. Es ist wichtig, dass<br />
die erarbeiteten Massnahmen in der häuslichen Umgebung<br />
der Betroffenen nach dem Klinikaufenthalt<br />
realistisch und einfach umsetzbar sind. Wir empfehlen<br />
zudem die Inhalte des Krisenplans mit den Angehörigen<br />
zu besprechen. Das Klären von Erwartungen<br />
hinsichtlich Beobachtung der Frühwarnsymptome<br />
und dem Ergreifen von Massnahmen kann zu einer<br />
Beruhigung im Familiensystem führen und Ängste<br />
reduzieren.<br />
DIE PERSÖNLICHE REFLEXION führt dazu, dass die<br />
Betroffenen mehr Klarheit über ihre eigene Situation<br />
erhalten. Dadurch wird Hoffnungs- und Hilflosigkeit<br />
reduziert und die Selbstwirksamkeit erhöht. Wenn<br />
die Betroffenen das Gefühl erhalten, auf zukünftige<br />
Krisen besser vorbereitet und diesen nicht wehrlos<br />
ausgeliefert zu sein, hat sich die präventive Wirkung<br />
des Krisenplans bestätigt.<br />
KARIN STUTTE MSCN | EHEMALS PFLEGEEXPERTIN PD<br />
Korrigenda soH MAGAZIN 2/20<strong>17</strong><br />
Ärzteausbildung und Bildungssystematik<br />
Es immer wieder schön zu erfahren, wie genau unsere Leser die Beiträge studieren.<br />
So sind in der letzten Ausgabe zwei Fehler sofort entdeckt worden. Gerne nehmen<br />
wir nun die Korrigenda vor:<br />
Seite 8: Die Weiterbildungsdauer zum Facharzt beträgt in der Regel 5 bis 6 Jahre,<br />
wobei die fachspezifische Weiterbildung in der Regel mindestens 3 Jahre umfasst.<br />
Festgehalten wird dies in der Weiterbildungsordnung (WBO) des Schweizerischen<br />
Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF).<br />
Seite 19: Die Fachhochschule und die Höhere Fachschule sind falsch bezeichnet.<br />
Die korrekte grafische Darstellung finden Sie unter ampuls.solothurnerspitaeler.ch.<br />
14<br />
15