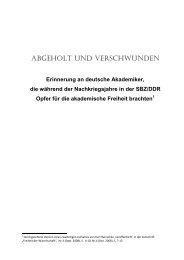April 2011 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
April 2011 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
April 2011 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
41<br />
freiheit <strong>der</strong> wissenschaft online – <strong>April</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Bund</strong> <strong>Freiheit</strong> <strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Entwicklung von Bildung und Erziehung in Deutschland verorten. Diese Darstellung hält<br />
übrigens für den am Aktionismus von Bildungspolitikern und selbsternannten pädagogischen<br />
Vordenkern Verzweifelnden den Trost parat, daß die Geschichte <strong>der</strong> Pädagogik schon immer<br />
Tendenzschwankungen nicht unerheblicher Stärke hatte und auch die<br />
Schulstrukturproblematik immer wie<strong>der</strong> aufgegriffen wurde und politisch bewältigt werden<br />
mußte.<br />
Das Buch ist auf je<strong>der</strong> Seite anregend. Es enthält vieles, dem man auch einmal geson<strong>der</strong>t<br />
nachgehen möchte.<br />
Von den Einzelthemen seien zwei herausgegriffen, die sicherlich einer Vertiefung bedürfen,<br />
obwohl <strong>der</strong> Verfasser selber schon sehr deutlich wird. Zum einen befaßt <strong>der</strong> Autor sich mit<br />
dem Thema „Inklusion“ in sehr grundsätzlicher Form (S. 80-99), zum an<strong>der</strong>en weist er auf<br />
einen bedeutungsvollen und nicht zu unterschätzenden Paradigmenwandel in <strong>der</strong><br />
bildungspolitischen Zielsetzung staatlichen Handelns hin (S. 100 ff.).<br />
Inklusion - Schonraumpädagogik/ Entlastungsstrategie und neue Ethik<br />
Die Diskussion des Themas „Inklusion“ hat sicherlich durch internationale Erklärungen und<br />
Konventionen einen beson<strong>der</strong>en Anstoß in Deutschland bekommen. Son<strong>der</strong>pädagogische<br />
För<strong>der</strong>ung ist auch ein Thema in den periodisch erscheinenden Bildungsberichten <strong>der</strong><br />
Kultusministerkonferenz.<br />
Auch bei diesem Thema gilt es, sich das vor Augen zu halten, was in dieser Hinsicht in<br />
Deutschland existiert und getan wird. Eine solche ehrliche Bestandsaufnahme gehört zu einer<br />
umfassenden Analyse, die Peter Brenner in Grundzügen vornimmt und historisch einordnet.<br />
Diese Analyse zeigt allerdings, daß es für die Erziehung von Menschen mit Behin<strong>der</strong>ungen<br />
Son<strong>der</strong>wege <strong>der</strong> Erziehung gibt, <strong>der</strong>en Charakter man mindestens als „ambivalent“ ansehen<br />
kann, nämlich sinnvoll und problematisch zugleich. Das dokumentiert übrigens auch <strong>der</strong><br />
Bildungsbericht <strong>der</strong> KMK, wenn er die Arten <strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>tenschulen aufzählt und zugleich<br />
den gemeinsamen Unterricht als ausbaufähig markiert.<br />
Das ist aber nicht genug. Denn nach Peter Brenner zeigt sich gerade in <strong>der</strong> Betonung <strong>der</strong><br />
Fürsorge, des caritas – Aspektes, das Dilemma <strong>der</strong> Erziehung Behin<strong>der</strong>ter in beson<strong>der</strong>en<br />
Einrichtungen. Hier ereigne sich so etwas wie „Schonraumpädagogik“. Auch sorge das<br />
Schulwesen selbst für son<strong>der</strong>pädagogischen För<strong>der</strong>bedarf, wenn es sich durch Zuweisung<br />
„schwieriger Fälle“ in beson<strong>der</strong>e Einrichtungen entlaste. Es müßte gelingen, Menschen mit<br />
Behin<strong>der</strong>ungen in den gleichen Einrichtungen wie die an<strong>der</strong>en und mit diesen zusammen zu<br />
unterrichten.<br />
Brenner formuliert dies aber nicht als schöne Vision einer erst dann heilen Welt, die etwa<br />
juristisch zu erkämpfen und durch Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> Finanzierungspraxis administrativ<br />
durchzusetzen wäre, son<strong>der</strong>n zeigt auf, worauf es dabei ankäme:<br />
Im tiefsten Grunde geht es ihm um die Frage einer neuen Ethik im Umgang mit Behin<strong>der</strong>ten.<br />
Diese Ethik setzt an <strong>der</strong> Erfahrung <strong>der</strong> pädagogischen Grenzsituation an, die durch die<br />
Anwesenheit Behin<strong>der</strong>ter im Unterricht entsteht. Das Nicht-Normale muß respektiert und,<br />
darf man hinzufügen, ausgehalten werden. Die pädagogische Grenzsituation markiert die<br />
Begegnung mit dem Menschen als Menschen, sie ist mehr und wirkt an<strong>der</strong>s als <strong>der</strong><br />
pädagogische Umgang mit Kin<strong>der</strong>n nach vorgegebenen Kriterien einer gesellschaftlichen<br />
Normierung.<br />
Indem die reformorientierte Pädagogik „vom Kinde aus“ das „gesunde und kräftige Kind“ vor<br />
Augen habe, sei sie schon ein Irrweg, <strong>der</strong> böse Folgen erzeugt habe und noch heute erzeuge -<br />
bis zu medizinischer Nachhilfe in zahllosen Fällen. Eine neue Ethik müsse ihren Maßstab am<br />
web<br />
fdw<br />
I/<strong>2011</strong>