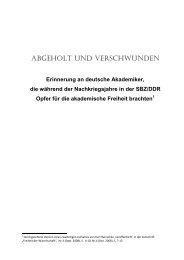April 2011 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
April 2011 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
April 2011 - Bund Freiheit der Wissenschaft eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
43<br />
„Narrativer Treibsatz“<br />
freiheit <strong>der</strong> wissenschaft online – <strong>April</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Bund</strong> <strong>Freiheit</strong> <strong>der</strong> <strong>Wissenschaft</strong><br />
Erzählungen und Geschichte sind nicht identisch: <strong>der</strong> Sozialwissenschaftler Eric Selbin fragt<br />
nach dem „narrativen Treibsatz“, <strong>der</strong> Geschichten von Rebellion, Revolte und Revolution zu<br />
entscheidenden Faktoren <strong>der</strong> Umgestaltung an einem bestimmten Ort und zu einem<br />
bestimmten Termin werden läßt. Der Autor identifiziert vier Archteypen von Revolutionen<br />
und erläutert sie als die Geschichte von <strong>der</strong> zivilisierenden und demokratisierenden<br />
Revolution, von <strong>der</strong> Sozialrevolution, von <strong>der</strong> Geschichte von Unabhängigkeit und <strong>Freiheit</strong><br />
sowie von „verlorenen und vergessenen Revolutionsgeschichten“. Es gelte dabei, Mittel<br />
herauszufinden, die Vergangenem einen Sinn geben, die Gegenwart erklären helfen und<br />
„Zukunft denkbar und möglich machen“. Angetrieben von neuen Technologien erzählen<br />
Zeitzeugen die Geschichte neu und schaffen Querverbindungen, um die elementare Frage<br />
nach dem „aufwühlenden Why?“ zu beantworten. Aus <strong>der</strong> Literaturwissenschaft kennen wir<br />
die intermediale Erzählforschung, die didaktisch auch im Fach für die Deutung von<br />
Geschichte genutzt wird (oral history-Projekte), in dem <strong>der</strong> Schüler nicht aus dem Konstrukt ,<br />
son<strong>der</strong>n methodisch an ihm lernt, um Fiktion und Absicht <strong>der</strong> Überlieferung zu entschlüsseln.<br />
Gerüchte, Geschichten tragen den „Stachel <strong>der</strong> Nachhaltigkeit“ in sich, um soweit konkret als<br />
Erzählungen in didaktischer Absicht als „imaginierte Geschichte“ entworfen, vom Fachlehrer<br />
wie<strong>der</strong> „dekonstruiert“ zu werden: „Wir erschaffen, verstehen und regeln unsere Welt durch<br />
die Geschichte, die wir erzählen.“<br />
„Unfinished agenda“<br />
Eric Selbin sieht in <strong>der</strong> „Historie“ nicht nur den Wissensvorrat, ein Gemisch aus Fakten und<br />
Fiktion, <strong>der</strong> Historiker als „Handwerker“ ist nicht allein <strong>der</strong> Wahrheit aus Tradition<br />
verpflichtet. Der Autor beklagt mit E. Galeano (1985) die Verarmung von Geschichte, weil<br />
vermittelte Geschichten von oben herab konstruiert, von Siegern komponiert, von Mächtigen<br />
orchestriert und für die Bevölkerung gespielt und rezitiert werden. Er plädiert für eine an<strong>der</strong>e<br />
Geschichte, in <strong>der</strong> Wahrnehmung des Menschen wurzelnd, sich kontinuierlich entwickelnd<br />
und aus <strong>der</strong> Lebenswelt <strong>der</strong> Zeitgenossen erschließend: in Formen <strong>der</strong> refragatio, rebellio et<br />
revolutio – aus Wi<strong>der</strong>stand, Rebellion und Revolution(en), bei denen es um Leidenschaft,<br />
große Opferbereitschaft und Durchsetzung von Prinzipien gehe. Er versteht seine Publikation<br />
als „Reiseführer“ durch Revolutionsgeschichten. Er sieht die Methode <strong>der</strong> narratio als<br />
separates Element und konstitutive Komponente <strong>der</strong> Geschichte und nutzt heuristisch Mythos,<br />
Erinnerung und Mimesis als Triebkräfte <strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ung: für den „Aufstand <strong>der</strong> Anekdoten“<br />
versucht er, universale Gesetzmäßigkeiten in einer Art Feldtheorie zu erfassen (Kap. 3), erfaßt<br />
in vier Schritten Revolutionstypen (Kap. 4 mit 7), erörtert die fragile, wenn auch hartnäckig<br />
verlorene und vergessene Revolutionsgeschichte (Kap. 8), um abschließend Revolutionen als<br />
die „Grundform soziopolitischen Kampfes“ und Werkzeug für die Gestaltung von Zukunft,<br />
als Katalysator für die Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Welt mit einer „unfinished agenda“ zu behandeln<br />
(Kap. 9). Zeitlich erfaßt <strong>der</strong> Autor Entwicklungen im alten Europa von <strong>der</strong> frühen Neuzeit bis<br />
ins 20. Jahrhun<strong>der</strong>t, er lenkt zudem den Blick auf Mittel- und Südamerika: das Titelbild zeigt<br />
protestierende Studenten in Teheran (1999) – Erkenntnisse aus dem Band sind angesichts<br />
brisanter Ereignisse zwischen Algerien, Ägypten und dem Jemen höchst aktuell.<br />
Willi Eisele<br />
web<br />
fdw<br />
I/<strong>2011</strong>