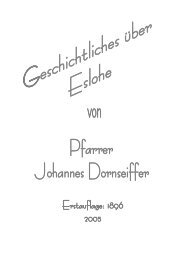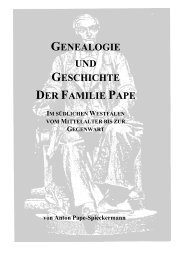Geschichtliches aus dem Sauerland - R.J.Sasse
Geschichtliches aus dem Sauerland - R.J.Sasse
Geschichtliches aus dem Sauerland - R.J.Sasse
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Kirchengeschichtliches <strong>aus</strong> <strong>dem</strong> <strong>Sauerland</strong>e<br />
richten; deshalb waren auch fast sämtliche Pastöre hierselbst Mönche <strong>aus</strong> Meschede. Wegen<br />
dieser Abhängigkeit von <strong>dem</strong> Kloster in Meschede glaubte die königliche Regierung bei Aufhebung<br />
des Klosters das Patronatsrecht über Eslohe beanspruchen zu können. Erst nach längeren<br />
Verhandlungen zwischen Arnsberg und Paderborn einigte man sich im Jahre 1853 dahin, das<br />
der Fiskus auf das Patronat verzichtete und der Bischof das alleinige und <strong>aus</strong>schließliche Besetzungsrecht<br />
haben solle.<br />
Kehren wir nun zu den Lorscher Annalen zurück. § 8 sagt: "Wenn im sächsischen Volke sich<br />
fernerhin ein Ungetaufter sich heimlich aufhalten und verbergen wollte, und zur Taufe zu<br />
kommen verschmähete und Heide bleiben wollte, der soll mit <strong>dem</strong> Tode bestraft werden: si<br />
quis deinceps in gente Saxonorum inter eos latens non baptizatus se abscondere volnerit et ad<br />
baptismum venire contemserit, paganusque permauere volnerit, morte moriatur.<br />
Wer noch im Zweifel sein sollte, ob wirklich das Christentum in unseren Landen schon um<br />
das Jahr 785 allgemein eingeführt gewesen ist, der braucht nur den § 8 der Reichsgesetze<br />
wiederholt zu lesen und zu studieren. "Wenn noch fernerhin ein Ungetaufter heimlich sich aufhalten<br />
und verbergen wollte" etc. - Also es sind nur vereinzelte Ausnahmen, dass noch ein Ungetaufter,<br />
ein Heide sich findet; alle anderen sind der christlichen Kirche durch die Taufe einverleibt.<br />
"Wer sich hartnäckig weigert, Christ zu werden und lieber Heide bleiben will, der soll -<br />
so hat es Allen gefallen, - so ist es von Reichswegen beschlossen worden, - er soll mit <strong>dem</strong><br />
Tode bestraft werden": morte moriatur.<br />
Es wird auch damals noch Hartnäckige gegeben haben, die sich der Kirche nicht anschließen<br />
mochten. In solchen Fällen wurde aber von Staatswegen kurzer Prozess gemacht, die Widerwilligen<br />
wurden <strong>aus</strong> ihrem Besitztum entfernt, und im Frankenlande, jenseits des Rheines, neu<br />
angesiedelt. Auf diese Weise wurden manche Güter frei, die nun durch kaiserliche Bestimmung<br />
zum Unterhalte von Kirchen und Priestern verwendet wurden.<br />
Nehmen wir noch den § 4 ins Auge: Si quis quadragesimale jejunium pro despectu Christianitatis<br />
contempserit, et carnem comederit, morte moriatur; "Wer die 40tägigen Fasten nicht<br />
hält, <strong>aus</strong> Verachtung gegen das Christentum, und Fleisch ist, der soll des Todes sterben." -<br />
Auch <strong>aus</strong> diesem Paragraphen ist ersichtlich, dass schon damals nicht bloß das innerkirchliche<br />
Leben, sondern auch das kirchliche Verhalten durch Strafgesetze fest umgrenzt war. Wie<br />
wäre dieses möglich und <strong>aus</strong>führbar gewesen, wenn die Bevölkerung in ihrer Mehrheit noch<br />
heidnisch gewesen wäre.<br />
Ähnliche Pönalgesetze haben sich bis ins 18. Jahrhundert, also über 1000 Jahre erhalten.<br />
"Wer an einem Sonntage sein Leinen bleichte, wurde mit einem Pfunde Wachs bestraft, das<br />
er an seine Kirche abzuliefern hatte." Beispiele dieser Art liefert unser Pfarrarchiv. Kurz und<br />
gut, von Kaiser Karl d. Gr., der 814 starb, rührt es her, dass die Kirche in unserem Sachsenlande<br />
schon so früh festen Fuß gefasst, und eine kirchlich soziale Verfassung zum Landesgesetz<br />
geworden ist.<br />
Nur die Wenigsten, selbst unter Studierten, sind es sich bewusst, wie weit man in Bezug auf<br />
Einführung des Christentums zurückgehen darf. Die Lorscher Annalen, von denen ich in meiner<br />
Studienzeit auch nicht ein Wörtchen vernommen habe, - wie Vielen mag es so ergangen sein?<br />
- geben sichere Auskunft. Da sehen wir wieder, was unser Vaterland den Mönchen und den<br />
Klöstern zu verdanken hat; in ihnen blühte Kunst und Wissenschaft. Auch hat speziell unsere<br />
Gegend eine auffällige Anhänglichkeit an Fulda bewahrt, in<strong>dem</strong> recht viele junge Leute dort<br />
ihre wissenschaftliche Ausbildung gesucht und gefunden haben. Das <strong>Sauerland</strong> darf sich sehen<br />
lassen. Dieser Ansicht huldigte auch der große Altertumsforscher Seibertz, der in seinen zwei<br />
Bänden: "Westfälische Beiträge zur deutschen Geschichte" eine große Reihe literarisch tätiger<br />
Männer <strong>aus</strong> unserer Heimat mit Angabe ihrer Werke namhaft gemacht hat. Möge es immer so<br />
bleiben und immer noch besser werden! Westfalen vor !!! -<br />
III. Abteilung: Pastöre in Bergh<strong>aus</strong>en<br />
1. Heinrich Sonneborn, von 1640 bis 1677, gebürtig <strong>aus</strong> Düsseldorf, Benediktiner-Pater <strong>aus</strong><br />
Grafschaft. Unter ihm war Küster in Bergh<strong>aus</strong>en unter anderen Jörge Himmelreich. Seib. Q.<br />
III. 450: "Henricus Sonneborn, pastor in Bergh<strong>aus</strong>en, qui de parsimonia sua novam monstrantiam<br />
pro ecclesia fieri curavit 1677: von seinen Ersparnissen ließ er für Grafschaft eine neue<br />
Monstranz machen." Sonneborn kommt in ff Urkunden vor: -<br />
6