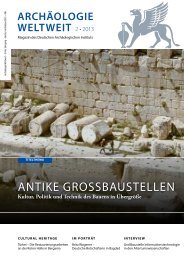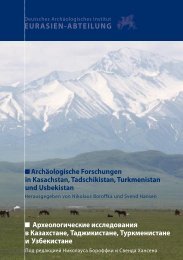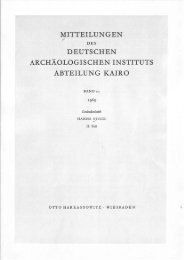Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
9<br />
J U N G S T E I N Z E I T<br />
Wanddekoration <strong>aus</strong> Ludwigshafen-Seehalde,<br />
Kr. Konstanz<br />
(Baden-Württemberg)<br />
Während verschiedener Abschnitte des Neolithikums waren die Uferzonen der<br />
Seen rings um die Alpen besiedelt. Die vorzüglichen Erhaltungsbedingungen<br />
haben zur Konservierung des Bauholzes der Häuser, aber auch zahlreicher Alltagsgegenstände<br />
<strong>aus</strong> organischen Materialien beigetragen.<br />
Durch die Jahrringbestimmung (Dendrochronologie) der Bauhölzer lässt sich<br />
die Errichtung von Häusern jahrgenau bestimmen. Es ist gelungen, eine komplette<br />
Sequenz der charakteristischen Jahrringe von Bäumen in Mitteleuropa<br />
aufzubauen. Heute reicht die Eichenchronologie bis 8480 v. Chr. zurück. An<br />
die Eichenchronologie ist eine frühholozäne Kiefernchronologie angeschlossen,<br />
die den Zeitbereich 7959-9931 v. Chr. abdeckt. Damit ist eine lückenlose<br />
12 000 Jahre umfassende Jahrringchronologie hergestellt.<br />
Die jungsteinzeitlichen Siedlungen am Bodensee können auf diese Weise<br />
zeitlich sehr genau bestimmt werden. So stammen die <strong>Funde</strong> <strong>aus</strong> der Ufersiedlung<br />
Ludwigshafen-Seehalde am Bodensee, die der älteren Pfyner Kultur<br />
angehören, <strong>aus</strong> den Jahren 3869 bis 3824 v. Chr. Die beiden fast lebensgroßen<br />
Brüste waren Bestandteil einer verputzen Rutenflechtwand eines H<strong>aus</strong>es.<br />
Der Verputz war mit dem Relief und weißer Farbe verziert. Es zeigen sich Winkelbänder,<br />
Dreiecke, Kreise und Punktfelder, die sich zu einem Gesamtdekor<br />
vereinigen (Abb. 8). Wegen der Verzierung und der Brüste hat man daran gedacht,<br />
dass es sich um einen Kultbau handeln könnte. Die weiblichen Brüste<br />
werden mit Vorstellungen von Fruchtbarkeit verbunden: Sie seien übersät von<br />
weißen Punkten, „dem Doppelsymbol der Fruchtbarkeit: ein Sternenregen,<br />
der die Menschenfrauen beglückenden himmlischen Mächte und die Milch<br />
der großen Sternenstraße“ (Müller-Beck). Das demonstrative Zeigen der Brüste<br />
lässt sich aber auch als ein Abwehrzauber verstehen.<br />
Man brachte in dieser Zeit plastische weibliche Brüste aber nicht nur an<br />
H<strong>aus</strong>wänden an, sondern verzierte in entsprechender Weise auch zahlreiche<br />
Tongefäße, sowohl flaschenartige Gefäße<br />
als auch kleine Töpfe und Krüge. Die Idee,<br />
durch die plastischen Brüste die Tongefäße<br />
letztlich zu weiblichen Körpern zu machen,<br />
hat eine bis in das 6. Jahrt<strong>aus</strong>end v.<br />
Chr. zurückreichende Tradition und war im<br />
4. Jahrt<strong>aus</strong>end nicht nur in Süddeutschland,<br />
sondern auch in der Schweiz und im<br />
Karpatenbecken weit verbreitet.<br />
26<br />
Abb. 8.<br />
27