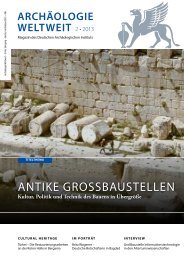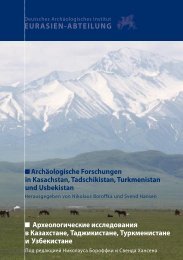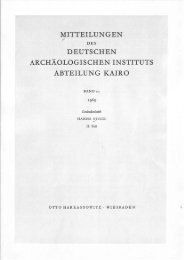Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
45<br />
F R Ü H E S M I T T E L A L T E R<br />
Abb. 30.<br />
Adlerfibel <strong>aus</strong> Oßmannstedt, Lkr. Weimarer Land<br />
(Thüringen)<br />
Aus einem Frauengrab stammt die 6 cm große Fibel in Form eines Adlers mit<br />
angelegten Flügeln. Sie war mit einer Bernsteinperle an einer 1,2 m langen<br />
Goldkette befestigt. Die Gewandschließe lag im Beckenbereich der Frau und<br />
hielt das Totengewand zusammen. Es handelt sich um eine charakteristische<br />
Arbeit in „Cloisionné“-Technik, die sich seit dem 4. Jahrhundert n. Chr.<br />
in Mittel- und Westeuropa großer Beliebtheit erfreute. Diese Technik wurde<br />
schon im 2. Jahrhundert n. Chr. in griechischen Werkstätten des nördlichen<br />
Schwarzmeerraums in großer Meisterschaft <strong>aus</strong>geführt. Letztlich geht sie auf<br />
hellenistischen Schmuck zurück. In die kleinen Zellen, die <strong>aus</strong> aufgelöteten<br />
Goldstegen gebildet werden, wurden farbige Steine, bevorzugt Almandine,<br />
eingesetzt. Bei der Oßmannstädter Fibel wurden für die die 47 unterschiedlich<br />
geformten Zellen flache Almandine verwendet, während das Auge des Adlers<br />
von einem konvex geschliffenen Almandin gebildet wird.<br />
Die Fibel und die übrigen Beigaben des Grabes, u. a. eine goldene Schnalle,<br />
ein goldener Fingerring, ein zerbrochener Bronzespiegel und zwei goldene<br />
Ohrringe, zeigen die Tote als Angehörige der Oberschicht. Das Motiv des Adlers<br />
als Vogel des Königs (und heute des Staats) unterstreicht die Position der<br />
Macht, an welcher die Verstorbene teilhatte. Das Grab wird in die Zeit zwischen<br />
450 und 490 n. Chr. datiert.<br />
Die Bestattete hatte einen künstlich deformierten Schädel (Abb. 30). Durch<br />
die Bandagierung des Kopfs im Kindsalter erreichte man seine charakteristische<br />
Form. Solche „Turmschädel“ gehörten zum Schönheitsideal, das besonders<br />
während des 5. Jahrhunderts n. Chr. bei den Hunnen gepflegt wurde.<br />
Künstliche Schädeldeformierungen sind aber schon weit früher praktiziert<br />
worden und lassen sich in verschiedenen<br />
Regionen Eurasiens bis in das Neolithikum<br />
verfolgen.<br />
Im 5. Jahrhundert n. Chr. hatten die in der<br />
ungarischen Tiefebene ansässigen Hunnen<br />
auch germanische Stammesgebiete in ihren<br />
Herrschaftsbereich einbezogen. Die<br />
militärische Niederlage des hunnischen<br />
Heeres unter ihrem König Attila gegen eine<br />
römisch-germanische Koalition auf den Katalaunischen<br />
Feldern 451 n. Chr. und Attilas<br />
Tod 453 n. Chr. beendeten den hunnischen<br />
Einfluss in Mitteleuropa.<br />
98<br />
99