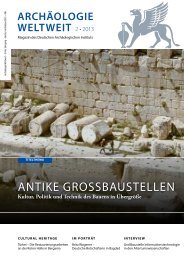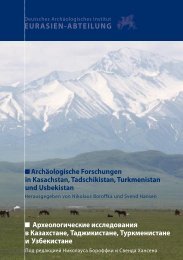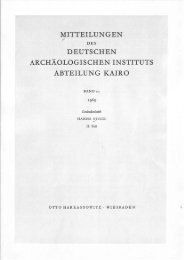Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Archäologische Funde aus Deutschland - Deutsches ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
15<br />
J U N G S T E I N Z E I T<br />
Grabfund <strong>aus</strong> Egeln, Ldkr. Aschersleben-Staßfurt<br />
(Sachsen-Anhalt)<br />
Das dritte Jahrt<strong>aus</strong>end v. Chr. ist in Europa durch die großräumige Verbreitung<br />
ähnlicher kultureller Erscheinungsformen charakterisiert: In Westeuropa<br />
spricht man von der Glockenbecherkultur (benannt nach charakteristischen<br />
Tongefäßen), in Mittel- und Nordosteuropa von der Schnurkeramik und im<br />
nördlichen Schwarzmeerraum von der Grubengrab- und Katakombengrabkultur<br />
(benannt nach typischen Grabformen). In weiten Teilen Europas setzte sich<br />
im dritten Jahrt<strong>aus</strong>end auch die Sitte der Einzelbestattung der Toten durch,<br />
während vor allem in Nordwesteuropa lange die Bestattung in Kollektivgräbern<br />
gepflegt wurde. Dieser Wechsel der Bestattungsform ist tiefgreifend und<br />
seine Bedeutung wurde sogar mit der Reformation im 16. Jh. verglichen.<br />
Glaubte man früher in diesen jeweils sehr ähnlichen kulturellen Ausdrucksformen<br />
Völker identifizieren zu können, die sich durch Wanderungen <strong>aus</strong>gebreitet<br />
hätten, hat sich heute die Ansicht weitgehend durchgesetzt, dass es<br />
sich bei einem jeweils kleinen Set von Objekten, z. B. einem Becher, einer Amphore<br />
und einer Axt um Statussymbole von Oberschichten handelt, die gleiche<br />
Wertvorstellungen teilten. Dass hierzu ein großer Trinkbecher und eine Waffe<br />
gehörten, verweist auf den männerbündischen und latent kriegerischen Charakter<br />
dieser Wertvorstellungen, die sicher rasch manifest werden konnten.<br />
Das Grab von Egeln lässt sich nach den 14C-Daten in die Zeit zwischen 2850<br />
und 2500 v. Chr. setzen. Bestattet war hier ein 30 bis 40jähriger Mann. Der in<br />
dem Grab gefundene Becher ist mit umlaufenden Schnurabdrücken verziert.<br />
Das auffälligste Stück aber ist die sogenannte Hammerkopfnadel <strong>aus</strong> Geweih.<br />
Sie ist ein in Mitteldeutschland ganz ungewöhnliches Stück. Die Hauptverbreitung<br />
solcher Nadeln liegt nämlich im nördlichen Schwarzmeerraum zwischen<br />
Karpatenbogen und Unterer Wolga, wo sie ein typisches Element der sog. Grubengrabkultur<br />
sind. Im Bereich der mitteldeutschen Schnurkeramik kommen<br />
Grabbeigaben <strong>aus</strong> Metall äußerst selten vor. Um so bemerkenswerter sind<br />
der Pfriem und der Dolch. Der kleine Pfriem mit pyramidenförmigem Schäftungsteil<br />
wurde nicht in Mitteldeutschland hergestellt. Seine Form ist im Nordschwarzmeerraum<br />
und dem Kaukasus geläufig. Für eine kaukasische Herkunft<br />
spricht auch, dass er <strong>aus</strong> Kupfer mit 2,8 % Arsenzusatz hergestellt wurde. Der<br />
kleine Dolch ist vermutlich ebenfalls ein Erzeugnis <strong>aus</strong> dem Nordschwarzmeerraum.<br />
So fand sich in einem Grabhügel der Grubengrabkultur im moldawischen<br />
Gradişte ein vergleichbarer Dolch mit einem Pfriem mit pyramidenförmigen<br />
Schäftungsteil. Die Beigaben <strong>aus</strong> dem Grab von Egeln sind ein Beispiel für die<br />
weiträumigen Kontakte während des dritten Jahrt<strong>aus</strong>ends.<br />
38<br />
39