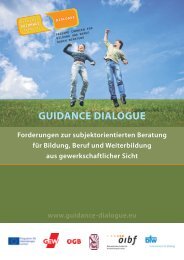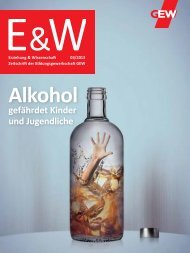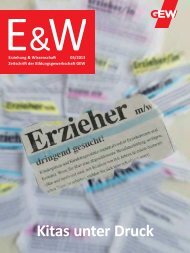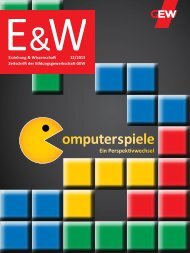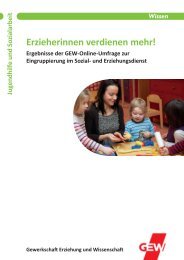E&W Dezember 2008 - GEW
E&W Dezember 2008 - GEW
E&W Dezember 2008 - GEW
- TAGS
- dezember
- www.gew.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
PISA-E<br />
Ex-Bürgermeister<br />
Henning Scherf<br />
(SPD) bekannte<br />
sich kurz nach<br />
Veröffentlichung<br />
der niederschmetternden<br />
PISA-Daten zur<br />
„politischen<br />
Schuld“.<br />
* Tillmann, K.J./Dedering,<br />
K./Kneuper,<br />
D./Kuhlmann, C./Nessel,<br />
I: PISA als bildungspolitisches<br />
Ereignis.<br />
Fallstudien in vier Bundesländern.<br />
VS-Verlag<br />
Wiesbaden <strong>2008</strong><br />
** OECD-PISA (Hrsg.)<br />
(2000): Schülerleistungen<br />
im internationalen<br />
Vergleich. Eine neue<br />
Rahmenkonzeption für<br />
die Erfassung von Wissen<br />
und Fähigkeiten.<br />
Berlin: MPI<br />
*** Mayntz, R. (2004):<br />
Governance im modernen<br />
Staat. In: Benz, A.<br />
(Hrsg.): Governance –<br />
Regieren in komplexen<br />
Regelsystemen. Wiesbaden:<br />
VS-Verlag<br />
Politik benutzt<br />
die PISA-Daten<br />
sehr gerne, um<br />
ohnehin getroffeneEntscheidungen<br />
zusätzlich oder<br />
im Nachhinein<br />
zu legitimieren.<br />
öffentlichen Widerstand gestoßen waren,<br />
nun politisch durchzudrücken.<br />
PISA übte, so gesehen, eine beschleunigende<br />
bzw. verstärkende Wirkung aus,<br />
bestimmte bildungspolitische Interessen<br />
durchzusetzen. Die Forderung nach<br />
zentralen Abschlussprüfungen wurde<br />
angesichts der schlechten PISA-Werte<br />
mehrheitsfähig – die SPD gab ihren Widerstand<br />
auf. Diese schnelle Entscheidung<br />
für zentrale Leistungsüberprüfungen<br />
unterstellte, dass damit die durch<br />
PISA aufgedeckten Defizite (Kompetenzdefizite<br />
in Lesen und Mathematik,<br />
hohe soziale Selektion) behoben werden<br />
könnten. Es ist aber empirisch überhaupt<br />
nicht erwiesen, dass kontinuierliche<br />
Leistungsüberprüfungen zu einem<br />
durchgängig verbesserten Unterricht<br />
und einem höheren Leistungsniveau<br />
führen.<br />
Allerdings war und ist ein großer Teil der<br />
Öffentlichkeit davon überzeugt, dass<br />
zentrale Prüfungen zu besseren Leistungen<br />
beitragen. Vor dem Hintergrund des<br />
besonders scharfen „PISA-Schocks“ in<br />
Bremen waren deshalb zentrale Prüfungen<br />
politisch nicht mehr zu stoppen.<br />
So wie in Bremen haben wir in unserer<br />
Untersuchung insgesamt 13 themenbezogene<br />
Fallstudien (zentrale Prüfungen,<br />
Ganztagsschule, Schulstruktur) durchgeführt,<br />
und zwar in vier Bundesländern<br />
(Brandenburg, Bremen, Rheinland-<br />
Pfalz, Thüringen). Welche Erkenntnisse<br />
haben wir aus der Analyse bildungspolitischer<br />
Prozesse nach PISA gewinnen<br />
22 Erziehung und Wissenschaft 12/<strong>2008</strong><br />
können? Versetzten die Befunde die<br />
„Steuerleute“ – also die politischen Entscheidungsträger<br />
– tatsächlich in die Lage,<br />
auf die schulischen Probleme angemessen<br />
zu reagieren und entsprechende<br />
Maßnahmen zu initiieren?<br />
Wir stellten zunächst fest, dass Vergleichsstudien<br />
wie PISA mit ihren Resultaten<br />
keinesfalls bevorzugt die „Steuerleute“<br />
beliefern, sondern vor allem eine<br />
sehr aktive Medienöffentlichkeit bedienen.<br />
Seit PISA müssen sich Kultusminister<br />
vor allem mit dem öffentlichen<br />
Bild der Ergebnisse auseinandersetzen.<br />
Sie versuchen deshalb, darauf Einfluss<br />
zu nehmen und es zugleich für ihre Interessen<br />
zu nutzen. Das heißt: Bildungspolitische<br />
Maßnahmen im Anschluss<br />
an PISA erscheinen aus der Sicht der<br />
Ministerien nur dann als sinnvoll, wenn<br />
sie zugleich die öffentliche Akzeptanz<br />
der Regierungspolitik stärken. Die Einführung<br />
zentraler Prüfungen beispielsweise<br />
weist genau dieses Legitimationspotenzial<br />
auf. Ein anderes Beispiel ist<br />
der Ausbau offener Ganztagsschulen,<br />
den fast alle Schulministerien nach<br />
PISA betrieben haben. Was folgt daraus?<br />
Bestätigt wird die politikwissenschaftliche<br />
Erkenntnis, dass (bildungs-)<br />
politische Reformen nicht nur nach<br />
sachlichen Gründen, sondern häufig<br />
auch „aus einem machtpolitischen Kalkül<br />
gewählt und verfolgt“ werden<br />
(Mayntz 2004***).<br />
Politische Handlungslogik<br />
Diese kritische Sicht auf die bildungspolitischen<br />
Prozesse darf man allerdings<br />
nicht auf eine naive Politik- und Politikerschelte<br />
reduzieren: Die von uns in<br />
den Blick genommenen Akteure in den<br />
Ministerien sind in aller Regel kenntnisreich<br />
und souverän mit den PISA-Ergebnissen<br />
umgegangen – allerdings souverän<br />
innerhalb ihrer politischen Handlungslogik.<br />
Was bedeutet das? Bildungspolitisches<br />
Handeln kann sich nicht allein<br />
auf eine gründliche Prüfung von<br />
Forschungsergebnissen stützen, um aus<br />
dieser Perspektive die „richtigen“ Maßnahmen<br />
abzuleiten. Vielmehr spielen in<br />
der bildungspolitischen Arena noch andere<br />
Faktoren, Interessen und Akteure<br />
eine Rolle: Koalitionskompromisse<br />
ebenso wie regionale Besonderheiten<br />
und finanzielle Bedingungen. Politik<br />
hat diese Faktoren alle abzuwägen – dabei<br />
sind die PISA-Daten nur ein Element<br />
unter vielen. Es zeigt sich aber<br />
auch, dass Politik die PISA-Studien sehr<br />
gern benutzt, um ohnehin getroffene<br />
Entscheidungen (etwa die Abschaffung<br />
der Orientierungsstufe in Bremen) zusätzlich<br />
oder im Nachhinein zu legiti-<br />
mieren. Mit PISA politisch begründet<br />
wurde, übrigens zeitgleich, in einem anderen<br />
Bundesland (Brandenburg) das<br />
genaue Gegenteil: die Beibehaltung des<br />
gemeinsamen Lernens in den Jahrgängen<br />
5/6.<br />
Nun soll hier nicht behauptet werden,<br />
dass politische Entscheidungen nie<br />
sach-, sondern immer nur macht- und<br />
interessenorientiert verlaufen. Aber die<br />
Vorstellung von einer rationalen Steuerung<br />
des Bildungssystems durch die Ergebnisse<br />
der empirischen Bildungsforschung<br />
greift zumindest für die hier beschriebenen<br />
Prozesse nach PISA zu<br />
kurz. Denn es bleibt nicht nur unklar,<br />
was unter „Steuerungswissen“ eigentlich<br />
zu verstehen ist und wie die „Steuerleute“<br />
in den Ministerien die „richtigen“<br />
Konsequenzen ziehen können. Entscheidend<br />
in diesem Kontext ist vielmehr,<br />
dass politische Legitimation eine<br />
hohe Relevanz besitzt. Daraus ergibt<br />
sich: Alle politisch vorgetragenen Argumente<br />
des Typs „Aus den PISA-Ergebnissen<br />
ergibt sich, dass nun auf jeden<br />
Fall die Maßnahme X zu realisieren ist“,<br />
sind äußerst skeptisch zu bewerten: Wie<br />
wird z. B. plausibel gemacht, dass die<br />
Maßnahme X bei den Schülerinnen und<br />
Schülern tatsächlich fachliche Kompetenzen<br />
verbessert oder soziale Selektivität<br />
verringert? Und welche Forschungsergebnisse<br />
belegen das? Gleichzeitig<br />
gilt: Alle Aussagen der Art, die<br />
Maßnahme Y (z. B. Veränderung der<br />
Schulstrukturen) löse nicht die Probleme<br />
und sei deshalb abzulehnen, stehen<br />
oft auf nicht weniger tönernen Füßen.<br />
Hier muss kritisch nachgefragt werden:<br />
Welche politischen Interessen stehen<br />
dahinter, bestimmte Reformen von<br />
vornherein auszunehmen?<br />
Fazit<br />
Fest steht: Ein direkter Zusammenhang<br />
zwischen PISA-Ergebnissen und bildungspolitischen<br />
Reformen – eine Art<br />
„Sachzwang“ – existiert nicht. Deshalb<br />
lassen sich „Steuerungsmaßnahmen“<br />
aus PISA nicht einfach ableiten. Welche<br />
Reformen der Öffentlichkeit als notwendig<br />
und sinnvoll präsentiert werden,<br />
wird vielmehr im politischen Diskurs<br />
entschieden. Wenn es der Fach- und<br />
Medienöffentlichkeit gelänge, in diesem<br />
Diskurs stärker die Sicht und die Interessen<br />
von Lehrkräften und Schülern<br />
einzubringen, wäre einiges gewonnen:<br />
Es bestünde dann zumindest die Chance,<br />
pädagogisches Handeln zielgenauer<br />
und an den Problemen orientierter auszurichten.<br />
Klaus-Jürgen Tillmann, Professor für<br />
Schulpädagogik em., Universität Bielefeld