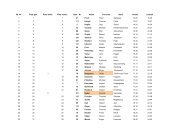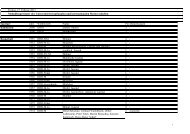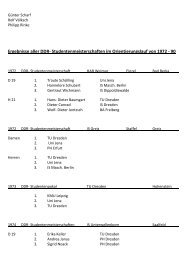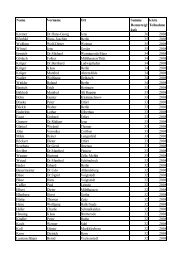Jenaer Beiträge Nr. 15 - Sport Geschichte Jena
Jenaer Beiträge Nr. 15 - Sport Geschichte Jena
Jenaer Beiträge Nr. 15 - Sport Geschichte Jena
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Strukturen und Wettkampsysteme im e<strong>Sport</strong><br />
Markus Breuer<br />
Lehrstuhl für <strong>Sport</strong>ökonomie, Institut für <strong>Sport</strong>wissenschaft,<br />
Friedrich-Schiller-Universität <strong>Jena</strong><br />
Zusammenfassung<br />
Mit dem elektronischen <strong>Sport</strong> (e<strong>Sport</strong>) hat sich in den vergangenen<br />
Jahren eine neue Form des sportlichen Wettbewerbs<br />
herausgebildet, die ohne die Entwicklungen<br />
im Bereich der digitalen Spiele nicht oder nur in anderer<br />
Form möglich gewesen wäre. Bezüglich der Strukturen und<br />
Wettkampfsysteme ähnelt der e<strong>Sport</strong> bereits heute, wenige<br />
Jahre nach seinem Entstehen, stark dem konventionellen<br />
Spitzen- und Mediensport und unterscheidet sich<br />
damit gleichzeitig von vielen Trendsportarten. Die Ähnlichkeit<br />
betrifft neben der Herausbildung von professionellen<br />
Wettbewerben insbesondere die Organisation der Aktiven<br />
in Vereinen, die teils als „eingetragene Vereine“, teils als<br />
Kapitalgesellschaften aufgebaut sind. Lediglich hinsichtlich<br />
des Verbandswesens wird bislang eine Sonderrolle<br />
eingenommen.<br />
Einleitung<br />
Der elektronische <strong>Sport</strong> (e<strong>Sport</strong>) stellt für die <strong>Sport</strong>wissenschaft<br />
im Allgemeinen und für die <strong>Sport</strong>ökonomie im Speziellen<br />
ein weitestgehend unbeachtetes Forschungsfeld dar.<br />
Der vorliegende Beitrag soll e<strong>Sport</strong> als „das wettbewerbsmäßige<br />
Spielen von Computer- oder Video-spielen im<br />
Einzel- oder Mehrspielermodus“ (Müller-Lietzkow, 2006:<br />
102) verstehen. Der Wettbewerbsgedanke verdient es besonders<br />
hervorgehoben zu werden, da er sich einerseits in<br />
den hier zitierten Definitionen wieder findet, andererseits<br />
eines der zentralen Zuwendungsmotive der Computerspielnutzung<br />
darstellt (Hartmann, 2008: 211 sowie die dort angegebenen<br />
Quellen). Nach diesem Verständnis gehört vor<br />
allem das gelegentliche Nutzen von elektronischen Spielen<br />
ohne kompetitiven Hintergrund nicht zum Untersuchungsgegenstand.<br />
Die Frage, ob e<strong>Sport</strong> dem <strong>Sport</strong> zuzurechnen<br />
ist, ist von Müller-Lietzkow (2007) bereits mit Hilfe einer<br />
Mehrebenen-Analyse behandelt worden. Besondere Übereinstimmungen<br />
konnten dabei im Bereich der Strukturen<br />
und der Wettkampfsysteme festgestellt werden, die auch<br />
im Fokus des vorliegenden Beitrages stehen sollen. In diesem<br />
Rahmen werden in concreto Mannschaf-ten, Ligenbetreiber<br />
und Turniere sowie Interessenvertretungen betrachtet.<br />
Die Darstellung beschränkt sich auf Deutschland.<br />
Eine internationale Betrachtung kann im Rahmen des vorliegenden<br />
Beitrags nicht geleistet werden.<br />
Mannschaften im e<strong>Sport</strong><br />
Schrammel (2006: 5) sieht in der Tatsache, dass sich im<br />
e<strong>Sport</strong> fest organisierte Einheiten bilden, einen Beleg<br />
dafür, dass sich die Beteiligten vermehrt als <strong>Sport</strong>ler im<br />
klassischen Sinne verstehen. Gleichwohl bezeichnen sich<br />
diese Einheiten in aller Regel nicht mit dem deutschen Terminus<br />
der Mannschaft oder des Vereins, vielmehr findet<br />
der Ausdruck des Clans Verwendung, ein Begriff, dessen<br />
Ursprung in der Ethnologie liegt und ursprünglich stammesähnliche<br />
Gemeinschaftsformen beschreibt. Im e<strong>Sport</strong><br />
bezeichnet der „Clan“ einen Zusammenschluss mehrerer<br />
Spieler (Top Ideas, 2007: 7) oder auch eine virtuelle<br />
Spielergemeinschaft (Fritz, 2003). Die Bedeutung für die<br />
Individuen ist dabei vielfältig. So dienen Clans einerseits<br />
der Organisation des Spiels bzw. <strong>Sport</strong>s, andererseits dienen<br />
sie als soziales Netzwerk. So ist belegt, dass sich 70<br />
% der jeweiligen Mitglieder auch außerhalb des e<strong>Sport</strong>s<br />
zu anderen Aktivitäten treffen (Sauer, 2004: 17). Teilweise<br />
werden die Termini Clan und Team synonym eingesetzt,<br />
was nach strenger Auslegung als falsch bezeichnet werden<br />
muss. So besteht ein Clan in der Regel aus mehreren<br />
Teams, abhängig davon, wie viele unterschiedliche Spiele<br />
betrieben werden; jedes Team widmet sich einem einzelnen<br />
Spiel (Wimmer, Quandt &Vogel, 2008: <strong>15</strong>2). Der<br />
Vergleich zum Mehrsparten-<strong>Sport</strong>verein liegt nahe. Die<br />
Größe eines Clans kann erheblich variieren, von einigen<br />
wenigen Spielern bis hin zu Vereinigungen von mehreren<br />
hundert Aktiven. Bis heute bestehen die meisten Clans<br />
ausschließlich aus Jugendlichen (Adamus, 2006: 146), ein<br />
ansteigendes Durchschnittsalter in den kommenden Jahren<br />
ist je-doch zu erwarten. Mit der Größe variiert auch die<br />
Motivation der Zusammenschlüsse. Nach Wenzler (2003:<br />
21) lassen sich drei Gruppen unterscheiden: Dies sind zum<br />
einen reine Fun-Clans, bei denen Spielspaß und soziale<br />
Interaktion im Vordergrund stehen, zum zweiten semiprofessionelle<br />
Clans, deren Ziele sowohl im Wettbewerb<br />
als auch im Spielspaß in der Gruppe liegen und schließlich<br />
sog. Pro-Gamer-Clans. Bei letzteren steht der Erfolg des<br />
Spiels im wettbewerblichen Vergleich zu anderen Personen<br />
oder Gruppierungen im Vordergrund. In der Regel findet<br />
eine Unterstützung technischer und finanzieller Art durch<br />
Sponsoren statt. Auch hier zeigt sich die Nähe zum konventionellen<br />
<strong>Sport</strong>. Die zitierte Einteilung ist jedoch nicht<br />
unumstritten. So versteht der Deutsche e<strong>Sport</strong>-Bund (esb)<br />
nur solche Gemeinschaften als Clan, die gemeinsam an<br />
Turnieren und Wettkämpfen teilnehmen. Die Gruppe der<br />
o. g. Fun-Clans wäre mittels dieser Definition ausgeschlossen.<br />
Eine Quantifizierung der in Deutschland aktiven Zusammenschlüsse<br />
fällt schwer. Die wohl am häufigsten zitierte<br />
Zahl beläuft sich auf 40.000 Mannschaften und wird vom<br />
e<strong>Sport</strong>-Bund vertreten. Während die Zusammenschlüsse<br />
der Breitensportler häufig nicht institutionalisiert sind, organisieren<br />
sich professionelle Clans vielfältig. Dies reicht<br />
von der Form eines eingetragenen Vereins über eine Limited<br />
(Ltd.) nach britischem Verständnis bis hin zu „Werksteams“<br />
wie sie bspw. aus dem Bayer-Konzern bekannt<br />
sind.<br />
e<strong>Sport</strong> Wettkämpfe: Turniere und Ligen<br />
Die mediale Verwertung sportlicher Wettkämpfe wird<br />
durch das Bestehen fester Strukturen bspw. in Form einer<br />
Liga, eines Cup-Wettbewerbes oder der Austragung von<br />
Titelkämpfen deutlich vereinfacht. Beim Vorliegen fester<br />
Strukturen verringern sich die individuellen In-formationskosten,<br />
die ein jeder Konsument bezüglich der beteiligten<br />
Parteien, des Austragungsortes, des Termins etc. zu tragen<br />
hat. Gleichzeitig vereinfacht sich Planung der Aktiven.<br />
Für die verschiedenen Ausprägungen des e<strong>Sport</strong>s sollen<br />
im Folgenden verschiedene Wettbewerbstypen vorgestellt<br />
werden.<br />
Im professionellen elektronischen <strong>Sport</strong> mit seiner ausgeprägten<br />
Markt- und Medienorientierung finden sich im Gegensatz<br />
zum europäischen Modell des klassischen <strong>Sport</strong>s<br />
durchgängig Veranstalter, die als Kapitalgesellschaften<br />
5