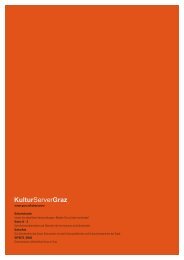KUNST- UND KULTURBERICHT DER STADT ... - Kulturserver Graz
KUNST- UND KULTURBERICHT DER STADT ... - Kulturserver Graz
KUNST- UND KULTURBERICHT DER STADT ... - Kulturserver Graz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2011 aufgrund ihrer Projekteingaben Mag a Angelika Reitzer<br />
und Dr. Max Höfler ausgewählt:<br />
Aus den Jurybegründungen:<br />
„Angelika Reitzer hat in den letzten fünf Jahren durch drei<br />
Buchpublikationen auf sich aufmerksam gemacht: In den beiden<br />
Romanen „Taghelle Gegend“ (2006) und „unter uns“ (2010) sowie<br />
dem Prosaband „Frauen in Vasen“ (2007) überzeugt sie<br />
durch eine klare und sachliche Sprache, mit der sie dichte Atmosphären<br />
und intensive Bilder von nachhaltiger poetischer<br />
Kraft schafft. Indem sie diese durch Perspektivenwechsel und<br />
einer beinahe filmisch wirkenden Schnitttechnik bricht, dringt<br />
sie hinter den schönen Schein der Gesellschaft vor. Ihre<br />
Figuren – es sind meist Frauenfiguren, die im Zentrum des<br />
fragmentarisch erzählten Geschehens stehen – sind zwar in<br />
einem konkreten Hier und Jetzt einer liberalen Wohlstandsgesellschaft<br />
verankert, doch befinden sie sich je auf einer<br />
diffusen Suche, der ihren Blick auf die Umgebung schärft.<br />
Angelika Reitzer gelingen in ihrer Prosa feine, kritische Porträts<br />
gesellschaftlicher Segmente, von jungen Künstlerinnen bis<br />
dominanten Großmüttern, von Freundschaften in Schwebe und<br />
Freundeskreisen, die am Problem eines Einzelnen scheitern.<br />
Doch sie schreibt auch Lyrik und dramatische Texte; sie ist eine<br />
produktive Schriftstellerin, deren einprägsame Stimme aus<br />
der österreichischen Literaturlandschaft nicht mehr wegzudenken<br />
ist.“<br />
„Max Höfler trat in der literarischen Öffentlichkeit der Stadt<br />
<strong>Graz</strong> und darüber hinaus seit nunmehr rund 10 Jahren als<br />
origineller Sprachakrobat in Erscheinung, der mit Elementen<br />
aus unterschiedlichen Formtraditionen raffiniert zu jonglieren<br />
L I T E R A T U R<br />
weiß. Trotz ihrer rhetorischen Exzentrik sind Höflers Sprachspiele<br />
keineswegs selbstzweckhaft: In Bezugnahme auf den<br />
Dadaismus und die Nachkriegs-Avantgarde (Wiener Gruppe)<br />
setzt der Autor sprachsatirische Verfahren mit Kalkül zur Durchleuchtung<br />
landläufiger Wirklichkeitskonstruktion ein.<br />
Während sein Debütroman „texas als texttitel“ (Ritter Verlag<br />
2010) männlich-chauvinistische Geschichtsbilder und damit<br />
assoziierte, die gesellschaftlichen Widersprüche übertünchende<br />
Erzählweisen aufs Korn nimmt, setzt sich Höfler<br />
in dem – in Auszügen für das Literaturstipendium der Stadt <strong>Graz</strong><br />
eingereichten, bislang unpublizierten – Text „wies is, is“ mit der<br />
bewusstseinssteuernden Wirkung von Mythen auseinander,<br />
die darauf abzielt, den Krieg als naturgegebenes Verfahren zur<br />
Konfliktbewältigung zu legitimieren. Das Skandalöse am<br />
Bewusstseinsschwindel der Sagen liege laut Höfler darin<br />
begründet, dass sich die ihnen imanenten martialischen<br />
Haltungen seit jeher und ungebrochen tagtäglich in unsere<br />
Gehirne – und das vom Kindesalter an – einschleichen.<br />
Aus der Dekonstruktion des Mythos vom Krieg als Naturgesetz<br />
folgt für Max Höfler naturgemäß die Zersetzung vermeintlich<br />
„naturgegebener“ Erzählformen. Um herkömmliche Weisen der<br />
Narration zu unterlaufen, bedient sich der Autor in „wies is, is“<br />
folgender Strategien: Da ist zum einen die verschachtelte Konstruktion<br />
seines Prosatextes, der gleichsam als ein im Entstehen<br />
begriffenes „komödienstück“ eingerichtet wird, zum<br />
anderen die Exotik der Stoffwahl in bezug auf die „Binnenerzählung“,<br />
die Material aus der altindischen Sage um den Gott<br />
Rama und den kriegerischen Affenkönig Hanuman („Ramajana“)<br />
verwendet. Als augenfälligste Strategie der Verfremdung erweist<br />
sich freilich das Sprachkostüm des Erzählers: Dessen<br />
Neigung, brachiale Gewalt comic-haft zu überzeichnen, seine<br />
vorgeschützte Naivität und vermeintliche stilistische Schnitzer<br />
<strong>KUNST</strong>- <strong>UND</strong> <strong>KULTURBERICHT</strong> 2011<br />
27