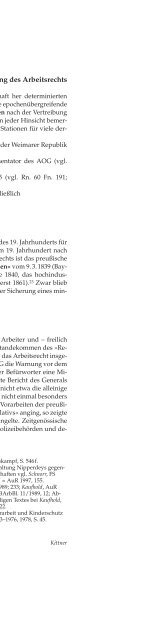PDF - Handbuch Arbeitsrecht
PDF - Handbuch Arbeitsrecht
PDF - Handbuch Arbeitsrecht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
19. Jahrhundert bis 1918<br />
GewO des Norddeutschen Bundes aufgehoben (1871 als GewO des Deutschen Reichs übernommen).<br />
57 Die dafür 1865 von Bismarck ins Feld geführten Argumente sind bis heute bemerkenswert:<br />
Die Koalitionsfreiheit der Arbeit sei zum einen aus Gründen der staatsbürgerlichen<br />
Gleichheit geboten. Sie werde zum anderen nicht zu zügellosen Streikaktivitäten<br />
führen, sondern die Arbeiter vielmehr zur Übernahme von Verantwortung anhalten. Und<br />
schließlich sei von dem von den Gewerkschaften ausgehenden Druck ein heilsames »Korrektiv<br />
gegen das zeitweilige, krankhafte Wachstum einzelner Industriezweige zu erwarten« 58<br />
(zur aktuellen ökonomischen Diskussion vgl. Rn. 126). Neben § 152 GewO stand aber der<br />
ebenfalls neu geschaffene § 153 GewO (abgeschafft erst 1918, vgl. Rn. 22). Diese Vorschrift ermöglichte<br />
eine Bestrafung wegen der Koalitionsbetätigung, soweit sie mit unerlaubten Mitteln<br />
verbunden war (z.B. Drohungen, Verrufserklärungen). § 152 und § 153 GewO setzten<br />
nun einen zwiespältigen, für das Kaiserreich kennzeichnenden Prozess in Gang: Während<br />
die Koalitionsbetätigung zivilrechtlich erlaubt war, wurde sie mit den Mitteln des Strafrechts<br />
schikanös behindert. Zu diesem Zweck wurden auch alle Möglichkeiten des Polizeiund<br />
Versammlungsrechts gegen die Gewerkschaften eingesetzt. In der Zeit des sog. Sozialistengesetzes<br />
59 von 1878 bis 1890 wurden sie als sozialdemokratische Vereine verfolgt und<br />
in die Illegalität gedrängt. Gleichwohl konnte ihre Entwicklung nicht aufgehalten werden.<br />
Die Gewerkschaften entwickelten sich zum einen aus lokalen Unterstützungsvereinen, zum<br />
anderen jeweils als Resultat konkreter Arbeitskämpfe. Als erste »richtige« Gewerkschaften<br />
wurden 1865 der »Deutsche Buchdruckerverein« und der »Allgemeine Deutsche Zigarrenarbeiter-Verein«<br />
gegründet. Nach dem Fall des Sozialistengesetzes entwickelten die Gewerkschaften<br />
sich als von der sozialdemokratischen Partei eigenständige Interessenvertretungen<br />
(neben den sozialdemokratisch orientierten »freien«, den deutlich kleineren »christlichen«<br />
und den – eher sozial-liberalen – »Hirsch-Duncker’schen« Gewerkschaften). 60 Sie überwanden<br />
in den eigenen Reihen Bedenken gegen die zunächst als »Harmonieduselei« verdächtigten<br />
Tarifverträge und nahmen sich dann dieses neuen Instruments erfolgreich an (allerdings<br />
kam es erst 1899 zu einem positiven Grundsatzbeschluss der freien Gewerkschaften). 61 Das<br />
wiederum veranlasste die AG – die freilich schon lange vorher als lokale und regionale<br />
Fabrikantenvereine organisiert präsent waren – seit den 70er Jahren, intensiv ab 1890 zur Bildung<br />
von Arbeitgeberverbänden, die mit Arbeitsnachweisen, »schwarzen Listen« und<br />
schließlich Flächenaussperrungen zunächst die Existenz der Gewerkschaften und danach<br />
den Abschluss von Tarifverträgen bekämpften. 62 Zwar war der Erfolg der Gewerkschaftsidee<br />
wie des Tarifvertrags offenkundig: 1913 hatten die Gewerkschaften ca. 2,3 Mio. Mitglieder;<br />
es existierten etwa 13500 Tarifverträge für 218000 Betriebe mit über 2 Mio. AN. 63 Jedoch<br />
gelang es ihnen nicht, in der Schwerindustrie und in den Zukunftsindustrien (Siemens,<br />
MAN) Fuß zu fassen und dort Tarifverträge durchzusetzen. Andererseits blieben Kaiser,<br />
Reichsregierung und konservative parlamentarische Kräfte mit ihren Versuchen zur Verschärfung<br />
des straf- und polizeirechtlichen Instrumentariums gegen Streiks (»Zuchthausvorlage«<br />
1899) erfolglos. Sie scheiterten damit jedoch durchweg im Reichstag.<br />
Das Tarifrecht der Kaiserzeit war normativ noch wenig geformt. 64 Tarifverträge waren zunächst<br />
rechtlich unverbindlich; Ansprüche aus ihnen konnten nicht vor staatlichen Gerichten<br />
eingeklagt werden. Initiativen zur Kodifizierung des Tarifvertragsrechts im Reichstag 65<br />
und des 29. Deutschen Juristentages 1908 66 blieben erfolglos. Sowohl die AG als auch die<br />
57 Zum Folgenden insgesamt Kittner, Arbeitskampf,<br />
S. 227ff.<br />
58 Vollständiger Text bei Blanke/Erd/Mückenberger/Stascheit,<br />
Hrsg., Kollektives <strong>Arbeitsrecht</strong>,<br />
Quellentexte zur Geschichte des<br />
<strong>Arbeitsrecht</strong>s in Deutschland, Band 1, 1975,<br />
S. 55f.<br />
59 »Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen<br />
der Sozialdemokratie« vom<br />
21. 10.1878 (RGBl. S. 351).<br />
60 Vgl. Kittner, Arbeitskampf, S. 239ff.<br />
61 Vgl. Ullmann, Tarifverträge und Tarifpolitik in<br />
Deutschland bis 1914, 1977.<br />
62 Vgl. Kittner, Arbeitskampf, S. 318ff.<br />
63 Vgl. Kittner, Arbeitskampf, S. 370ff.<br />
64 Vgl. Kittner, Arbeitskampf, 370ff.<br />
65 Vgl. Nautz, Das deutsche Tarifrecht zwischen<br />
Interventionismus und Autonomie, in Nutzinger,<br />
Hrsg., Die Entstehung des <strong>Arbeitsrecht</strong>s in<br />
Deutschland, 1998, S. 71 [72f.].<br />
66 Vgl. Becker, Arbeitsvertrag und Arbeitsverhältnis<br />
in Deutschland, 1995, S. 305ff.<br />
Kittner 9<br />
19<br />
20