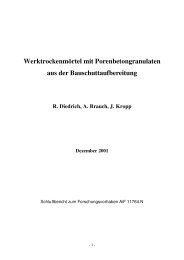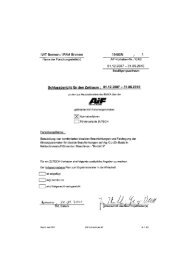Pilotprojekt Eilsum - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Pilotprojekt Eilsum - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Pilotprojekt Eilsum - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2 Wandmalerei<br />
2.1 BESTANDSBESCHREIBUNG DER WANDMALEREI (17, 4)<br />
Die in den Chorturm eingebettete Apsis zeigt ein vielfiguriges Ausmalungsprogramm,<br />
das heute zwar geschädigt, aber dennoch in beachtlich umfangreichen<br />
Resten erhalten ist (Abb. 2): In der unteren Zone die 12 Apostel, sehr l ebendig<br />
in variierender Körperhaltung zwischen Säulen und Architrav angeordnet,<br />
darüber überlebensgroß der thronende Christus in der Mandorla, umgeben<br />
von den vier Evangelistensymbolen Engel, Adler, Stier und Löwe. Zu den<br />
beiden Seiten erweitern je zwei Adoranten die Szene. Nach Norden Maria und<br />
ein Heiliger, nach Süden Johannes der Täufer und eine Bischhofsfigur. Die<br />
Wandmalereien gehören formal und stilistisch eindeutig in die unmittelbare<br />
Nachfolge des Zackenstils. Die Entstehung der <strong>Eilsum</strong>er Malerei kann aus<br />
dem Grunde in der Mitte 13. Jahrhunderts (1230/40) zugeordnet werden.<br />
Der genaue Aufbau der Wandmalerei, Maltechniken und Malschichtaufbau<br />
konnte im Rahmen dieses Projektes nicht flächendeckend geklärt werden und<br />
stellt somit eine noch zu bewerkstelligende dringliche Aufgabe dar. Bei dem<br />
Malereiträger handelt es sich um eine halbsteinig gemauerte Kalotte (Dicke ca.<br />
18 cm). Die Aufgehenden Wände bestehen im Norden und Osten aus einer<br />
190 cm starken Ziegelwand; der südliche Teil der Wandmalerei wird von einer<br />
etwa 50 cm stark Ziegelmauerwerk getragen. Die 1967 restaurierte Wandmalerei<br />
selber besteht aus einem Kalkmörtel mit Kalkspratzen und Bruchstücken<br />
von Muschelschalen. Als Binde- und Festigungsmittel wurden Kalkkasein aber<br />
auch vereinzelt Kieselsäureester eingesetzt.<br />
2.1.1 Frühere Freilegung (17, 7)<br />
Bereits bei der Freilegung 1963/69 und 1970 zeigten sich neben nahezu intakten<br />
Partien Bereiche, an denen die Malerei weitestgehend verloren war<br />
(Abb. 3), so im unteren Apsisrund und am oberen Teil der Kalotte. Ursache<br />
war der Wassereintrag über die Schallöffnung des Turmes und über die Außenfassade.<br />
Zu Beginn der damaligen Freilegung waren, bedingt durch die<br />
hohe Wandfeuchtigkeit die Tüncheflächen im Chor flächig mit einer dichten<br />
Mikroflora (Algen, Pilze und Bakterien) überzogen. Gipskrusten die zu einem<br />
festen Verbund zwischen jüngeren Übermalungen und den mittelalterlichen<br />
Malschichten geführt hatten, erschwerten die Freilegung. Die Haftung des Originalputzes<br />
auf dem Ziegelmauerwerk war durch großflächige Hohlstellenbildung<br />
ungenügend.<br />
Zur Konservierung der Malerei wurden Materialien eingesetzt, die sich in der<br />
Rückschau als extrem problematisch erwiesen haben. Insbesondere Kalkkaseinmörtel<br />
und -fixagen führten bei dem feuchten Makro- und Mikromilieu zu<br />
einem verstärktem mikrobiellen Wachstum. Wirkungsvolle Maßnahmen zur<br />
Eindämmung des Feuchtigkeitseintrags, etwa die Schließung der Schallöffnungen<br />
am Turm oder die Reparatur des Außenmauerwerks, waren einerseits<br />
nicht finanzierbar oder wurden anderseits mit den Schäden an der Wandmal erei<br />
nicht in Zusammenhang gebracht, so daß sich bis 1989 an diesem Zustand<br />
kaum etwas änderte.<br />
Untersuchungsbericht 1995, <strong>Pilotprojekt</strong> <strong>Eilsum</strong> W-2947 Seite<br />
11