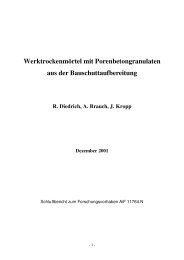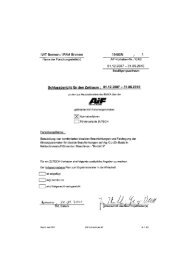Pilotprojekt Eilsum - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Pilotprojekt Eilsum - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Pilotprojekt Eilsum - Amtliche Materialprüfungsanstalt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5.2.3 Ziegeluntersuchungen Materialkennwerte (16)<br />
Das untersuchte historische Ziegelmaterial (Feldbrand) dokumentiert ein relativ<br />
poröses Scherbengefüge. Wasseraufnahmewerte von 13,8 bis 28,4 Gew.-<br />
% und Rohdichten von 1,51 bis 1,85 g/cm 3 belegen dies für die untersuchten<br />
Ziegel. Das Gefügebild wird durch eine Grundmatrix aus Quarz, Feldspat, Hamatit<br />
und röntgenografisch nicht eindeutig nachweisbaren Umwandlungsprodukten<br />
aus dem beginnenden Sinterprozeß und durch Verwendung von ausgebrannten<br />
hochporisierten Materialien wie Aschen und/oder Schlacken gebildet.<br />
Die Verwendung von diatomeenerdehaltigen tonigen Rohstoffen neben<br />
dem Einsatz von küstennahen Schluffen und Tonen, die zum Teil Muschelschalenreste<br />
enthalten, konnten durch die Mikroskopie deutlich belegt werden.<br />
Die historischen Ziegel weisen Brenntemperaturschwankungen und die für<br />
Handformgebung typischen Quetsch-Formgebungsrisse auf. Noch intakte<br />
Steine weisen eine feste und dichte Brennhaut und einen überwiegend zur<br />
Reduktionskernbildung neigenden Ziegelkern auf. Dieses ist bedingt durch die<br />
Massezusammensetzung bei kompakten Vollziegeln und durch die Brandführung.<br />
Unter heutigen Gesichtspunkten betrachtet entsprechen die Ziegel mit Druckfestigkeiten<br />
von 6,9 bis 10,7 N/mm 2 und der o. gen. Rohdichte einem Hintermauerziegel<br />
und ist eindeutig für einen Außenmauerziegel zu weich gebrannt.<br />
Dementsprechend stark ist auch der Zerstörungsgrad des Ziegels.<br />
5.3 KLIMATISCHE UND FEUCHTETECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN<br />
DES MAUERWERKS<br />
5.3.1 Feuchtehaushalt der Wand (1)<br />
Der Wärme- und Feuchtehaushalt von Gebäudewänden resultiert aus dem<br />
Zusammenspiel einer Vielzahl komplexer physikalischer und chemischer Vorgänge,<br />
die - sich überlagernd und miteinander gekoppelt - zum einen innerhalb<br />
des Mauerwerks, zum anderen in der auf beiden Seiten des Mauerwerks<br />
angrenzenden Luft ablaufen.<br />
Die Mauerwerksfeuchte oder auch Stoffeuchte kann durch die ständig wechselnden<br />
Luftfeuchten, vorwiegend an den oberflächennahen Zonen, in Abhängigkeit<br />
der Stoffübertragung von der Luft auf die Wand (Luftgeschwindigkeit)<br />
beeinflußt werden. Außerdem kann durch Kondensation auf der Oberfläche<br />
und oder in dem Mauerwerk selber, durch Schlagregen und durch kapillar au fsteigende<br />
Grund-, Ablauf- und Sickerwasser der Feuchtigkeitshaushalt erheblich<br />
angehoben werden.<br />
Das Mauerwerk weist einen hohen Wassergehalt auf der vom Innenraum nach<br />
außen zunimmt. Es traten massebezogene Wassergehalte (raumseitig) von<br />
ca. 3.5 Gew.-%. Hervorgerufen wird dieser Feuchtigkeitsanstieg aller Wahrscheinlichkeit<br />
durch das über die Außenfassade eindringenden Wasser. Etwa<br />
85 % des Schlagregens (ø über Jahr 2,6 mm/h) werden von der Wand aufgenommen.<br />
Die Tiefenmessungen (Meßlanze) wiesen bei Meßorten bis zu einer<br />
Höhe von 3,50 m extrem hohe Materialfeuchten auf. Sie lagen bei den installierten<br />
Meßpunkten im überhygroskopischen Bereich. Auch während andauernder<br />
langer Wärmeperioden sank die Materialfeuchte nicht unterhalb 100 %<br />
RF.<br />
Da die Wandfeuchtigkeit nur sehr langsam über die Oberflächen der Außenfassade<br />
abgeführt werden kann, durch die desolate Außenfassade<br />
Untersuchungsbericht 1995, <strong>Pilotprojekt</strong> <strong>Eilsum</strong> W-2947 Seite<br />
41