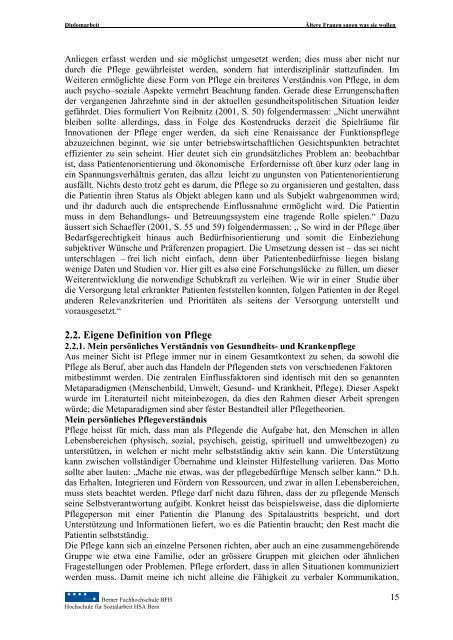Alte Frauen sagen was sie wollen - Socialnet
Alte Frauen sagen was sie wollen - Socialnet
Alte Frauen sagen was sie wollen - Socialnet
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Diplomarbeit Ältere <strong>Frauen</strong> <strong>sagen</strong> <strong>was</strong> <strong>sie</strong> <strong>wollen</strong><br />
Anliegen erfasst werden und <strong>sie</strong> möglichst umgesetzt werden; dies muss aber nicht nur<br />
durch die Pflege gewährleistet werden, sondern hat interdisziplinär stattzufinden. Im<br />
Weiteren ermöglichte diese Form von Pflege ein breiteres Verständnis von Pflege, in dem<br />
auch psycho–soziale Aspekte vermehrt Beachtung fanden. Gerade diese Errungenschaften<br />
der vergangenen Jahrzehnte sind in der aktuellen gesundheitspolitischen Situation leider<br />
gefährdet. Dies formuliert Von Reibnitz (2001, S. 50) folgendermassen: „Nicht unerwähnt<br />
bleiben sollte allerdings, dass in Folge des Kostendrucks derzeit die Spielräume für<br />
Innovationen der Pflege enger werden, da sich eine Renaissance der Funktionspflege<br />
abzuzeichnen beginnt, wie <strong>sie</strong> unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet<br />
effizienter zu sein scheint. Hier deutet sich ein grundsätzliches Problem an: beobachtbar<br />
ist, dass Patientenorientierung und ökonomische Erfordernisse oft über kurz oder lang in<br />
ein Spannungsverhältnis geraten, das allzu leicht zu ungunsten von Patientenorientierung<br />
ausfällt. Nichts desto trotz geht es darum, die Pflege so zu organi<strong>sie</strong>ren und gestalten, dass<br />
die Patientin ihren Status als Objekt ablegen kann und als Subjekt wahrgenommen wird,<br />
und ihr dadurch auch die entsprechende Einflussnahme ermöglicht wird. Die Patientin<br />
muss in dem Behandlungs- und Betreuungssystem eine tragende Rolle spielen.“ Dazu<br />
äussert sich Schaeffer (2001, S. 55 und 59) folgendermassen: „ So wird in der Pflege über<br />
Bedarfsgerechtigkeit hinaus auch Bedürfnisorientierung und somit die Einbeziehung<br />
subjektiver Wünsche und Präferenzen propagiert. Die Umsetzung dessen ist – das sei nicht<br />
unterschlagen – frei lich nicht einfach, denn über Patientenbedürfnisse liegen bislang<br />
wenige Daten und Studien vor. Hier gilt es also eine Forschungslücke zu füllen, um dieser<br />
Weiterentwicklung die notwendige Schubkraft zu verleihen. Wie wir in einer Studie über<br />
die Versorgung letal erkrankter Patienten feststellen konnten, folgen Patienten in der Regel<br />
anderen Relevanzkriterien und Prioritäten als seitens der Versorgung unterstellt und<br />
vorausgesetzt.“<br />
2.2. Eigene Definition von Pflege<br />
2.2.1. Mein persönliches Verständnis von Gesundheits- und Krankenpflege<br />
Aus meiner Sicht ist Pflege immer nur in einem Gesamtkontext zu sehen, da sowohl die<br />
Pflege als Beruf, aber auch das Handeln der Pflegenden stets von verschiedenen Faktoren<br />
mitbestimmt werden. Die zentralen Einflussfaktoren sind identisch mit den so genannten<br />
Metaparadigmen (Menschenbild, Umwelt, Gesund- und Krankheit, Pflege). Dieser Aspekt<br />
wurde im Literaturteil nicht miteinbezogen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen<br />
würde; die Metaparadigmen sind aber fester Bestandteil aller Pflegetheorien.<br />
Mein persönliches Pflegeverständnis<br />
Pflege heisst für mich, dass man als Pflegende die Aufgabe hat, den Menschen in allen<br />
Lebensbereichen (physisch, sozial, psychisch, geistig, spirituell und umweltbezogen) zu<br />
unterstützen, in welchen er nicht mehr selbstständig aktiv sein kann. Die Unterstützung<br />
kann zwischen vollständiger Übernahme und kleinster Hilfestellung variieren. Das Motto<br />
sollte aber lauten: „Mache nie et<strong>was</strong>, <strong>was</strong> der pflegebedürftige Mensch selber kann.“ D.h.<br />
das Erhalten, Integrieren und Fördern von Ressourcen, und zwar in allen Lebensbereichen,<br />
muss stets beachtet werden. Pflege darf nicht dazu führen, dass der zu pflegende Mensch<br />
seine Selbstverantwortung aufgibt. Konkret heisst das beispielsweise, dass die diplomierte<br />
Pflegeperson mit einer Patientin die Planung des Spitalaustritts bespricht, und dort<br />
Unterstützung und Informationen liefert, wo es die Patientin braucht; den Rest macht die<br />
Patientin selbstständig.<br />
Die Pflege kann sich an einzelne Personen richten, aber auch an eine zusammengehörende<br />
Gruppe wie etwa eine Familie, oder an grössere Gruppen mit gleichen oder ähnlichen<br />
Fragestellungen oder Problemen. Pflege erfordert, dass in allen Situationen kommuniziert<br />
werden muss. Damit meine ich nicht alleine die Fähigkeit zu verbaler Kommunikation,<br />
Berner Fachhochschule BFH<br />
Hochschule für Sozialarbeit HSA Bern<br />
15