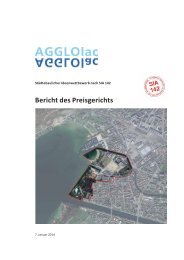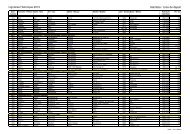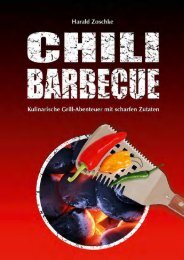Erziehungsverständnisse in evangelikalen ... - Bieler Tagblatt
Erziehungsverständnisse in evangelikalen ... - Bieler Tagblatt
Erziehungsverständnisse in evangelikalen ... - Bieler Tagblatt
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rolle der Eltern<br />
Im dogmatisch-autoritativen Verständnis von Erziehung wird die Vorbildrolle der Eltern stark betont. Das<br />
Verständnis der elterlichen Rolle ist viel komplexer und flexibler als bei den vorgängig beschriebenen <strong>Erziehungsverständnisse</strong>n.<br />
Die Eltern agieren dem K<strong>in</strong>d gegenüber je nach Situation <strong>in</strong> verschiedenen Rollen,<br />
etwa als Autorität, als zuhörender Partner, als erfahrene Expert<strong>in</strong> oder als Spielkamerad<strong>in</strong>.<br />
8.4.3 Berücksichtigung k<strong>in</strong>dlicher Grundbedürfnisse<br />
Grundsätzlich s<strong>in</strong>d beim dogmatisch-autoritativen Erziehungsverständnis die Eltern-K<strong>in</strong>d-Beziehungen von<br />
liebevoller Zuwendung geprägt, die k<strong>in</strong>dlichen Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Schutz und Regulation<br />
werden weitgehend abgedeckt – es gibt aber E<strong>in</strong>schränkungen. So wird zwar die k<strong>in</strong>dliche Individualität<br />
berücksichtigt, es kann aber vorkommen, dass diese von dogmatischen Setzungen (das „neidische” K<strong>in</strong>d,<br />
das „sündige” K<strong>in</strong>d) überblendet wird. Das K<strong>in</strong>d kann grossenteils jene Erfahrungen machen, die se<strong>in</strong>em<br />
Entwicklungsstand angemessen und förderlich s<strong>in</strong>d – es gibt aber, gerade auch im Zusammenhang mit<br />
Glaubens<strong>in</strong>halten („Verlorense<strong>in</strong>”, „Dämonen”) und dogmatischen Zuschreibungen („sündig”), Erfahrungen,<br />
die es nur schwer <strong>in</strong>tegrieren kann. Häufig erlebt das K<strong>in</strong>d mit zunehmender Autonomie und Reife immer<br />
rigidere Grenzen. Das hat damit zu tun, dass der Zielkonflikt zwischen Autonomieentwicklung und Erziehung<br />
zum Glauben immer ausgeprägter wird. Es hat aber auch mit neu aufsche<strong>in</strong>enden Themen zu tun, vor allem<br />
jenem der Sexualität, welche nach evangelikaler Doktr<strong>in</strong> nur <strong>in</strong>nerhalb der Ehe Platz hat. Auch die für den<br />
Übergang <strong>in</strong>s Erwachsenenleben wichtige Integration <strong>in</strong> Gleichaltrigengruppen wird zum Teil erschwert.<br />
8.4.4 Vorkommen von Gewalt<br />
Körperliche Gewalt<br />
Auch bei diesem Erziehungsverständnis kommt Körperstrafe vor, allerd<strong>in</strong>gs gibt es diesbezüglich Unterschiede.<br />
So spricht sich Mauerhofer (2011b) für körperliche Bestrafung aus, allerd<strong>in</strong>gs als letztes Mittel. Er<br />
schränkt auch e<strong>in</strong>, dass diese Erziehungsmassnahme nicht für alle K<strong>in</strong>der notwendig sei. Etter (2010) me<strong>in</strong>t,<br />
dass Körperstrafe heute <strong>in</strong> der Erziehung nicht mehr e<strong>in</strong>gesetzt werden sollte, es gibt jedoch Stellen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em<br />
Ratgeber, wo e<strong>in</strong>e diesbezüglich ambivalente Haltung durchsche<strong>in</strong>t. Die Autoren Mühlan (2012) sprechen<br />
von „e<strong>in</strong>em Klaps” aufs Händchen oder Mündchen. Silk (2010) befürwortet körperliche Strafe (e<strong>in</strong><br />
Schlag aufs Gesäss) an e<strong>in</strong>er Stelle des Buches. Kimmel (2004) versteht körperliche Züchtigung durchaus<br />
als e<strong>in</strong>e der möglichen diszipl<strong>in</strong>arischen Massnahmen.<br />
Ruthe (2011) äussert sich nicht zum Thema, spricht sich jedoch <strong>in</strong> anderen Ratgebern explizit gegen Körperstrafe<br />
aus. Auch bei der Fly High-Elternkonferenz wird auf die schädlichen Folgen von körperlicher Bestrafung<br />
h<strong>in</strong>gewiesen (Fly High-Elternkonferenz 2012).<br />
Psychische Gewalt<br />
Psychische Gewalt ergibt sich bei diesem Erziehungsverständnis z.T. aus der Notwendigkeit der Glaubensvermittlung.<br />
So gibt es bei e<strong>in</strong>em der Kursmodule nach Holmen und Teixeira (2009, S. 78) so genannte<br />
„Notizen im Auto-Zettel” mit verschiedenen Fragen zum Gottesdienst, welche die Familie auf der Heimfahrt<br />
ausfüllen soll. Bei den Fragen geht es um die eigene Haltung zum Gottesdienst, ob sich diese verändert<br />
hat, welcher Teil des Gottesdienstes besonders gefallen hat sowie darum, welche Botschaft Gott vermitteln<br />
wollte. Es wird durch die Fragen suggeriert, dass die Gottesdienstbesucher verändert werden sollten,<br />
was wiederum mit der eigenen E<strong>in</strong>stellung <strong>in</strong> Zusammenhang gebracht wird. Dass diese „richtig“ oder<br />
„falsch“ se<strong>in</strong> kann, ergibt sich aus dem Kontext. Kritisches Nachdenken sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>em Offense<strong>in</strong> für Gottes<br />
Botschaft entgegenzustehen. Der Zweitklässler – um diese Altersgruppe geht es bei dem Input – stösst mit<br />
se<strong>in</strong>en sieben oder acht Jahren vermutlich bereits beim Gottesdienst an se<strong>in</strong>e Grenzen. Den manipulativen<br />
Charakter der Fragen wird er kaum erkennen, sich aber möglicherweise schuldig fühlen, wenn er den Gottesdienst<br />
nur langweilig fand oder ke<strong>in</strong>e Botschaft Gottes empfangen hat.<br />
Psychische Gewalt zeigt sich aber auch <strong>in</strong> Zusammenhang mit <strong>evangelikalen</strong> Setzungen. Mühlans (2012)<br />
äussern sich folgendermassen zu Homosexualität: „Die Bibel verurteilt das jedoch als Sünde, weil der<br />
32