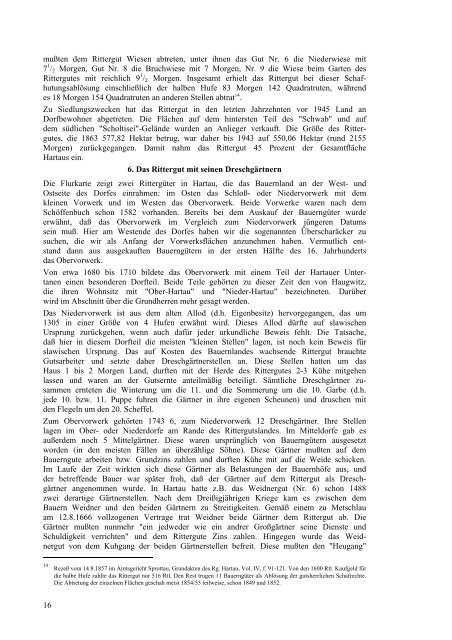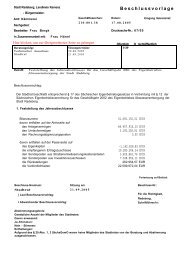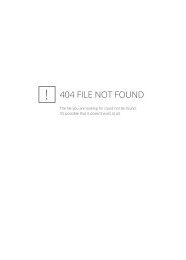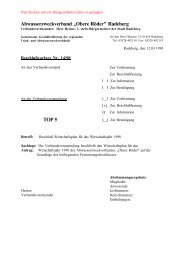Zwei Dorfstudien aus Westschlesien - Familie Spiegel in Radeberg
Zwei Dorfstudien aus Westschlesien - Familie Spiegel in Radeberg
Zwei Dorfstudien aus Westschlesien - Familie Spiegel in Radeberg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mußten dem Rittergut Wiesen abtreten, unter ihnen das Gut Nr. 6 die Niederwiese mit<br />
7 1 / 2 Morgen, Gut Nr. 8 die Bruchwiese mit 7 Morgen, Nr. 9 die Wiese beim Garten des<br />
Rittergutes mit reichlich 9 1 / 2 Morgen. Insgesamt erhielt das Rittergut bei dieser Schafhutungsablösung<br />
e<strong>in</strong>schließlich der halben Hufe 83 Morgen 142 Quadratruten, während<br />
es 18 Morgen 154 Quadratruten an anderen Stellen abtrat 14 .<br />
Zu Siedlungszwecken hat das Rittergut <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten vor 1945 Land an<br />
Dorfbewohner abgetreten. Die Flächen auf dem h<strong>in</strong>tersten Teil des "Schwab" und auf<br />
dem südlichen "Scholtisei"-Gelände wurden an Anlieger verkauft. Die Größe des Rittergutes,<br />
die 1863 577,82 Hektar betrug, war daher bis 1943 auf 550,06 Hektar (rund 2155<br />
Morgen) zurückgegangen. Damit nahm das Rittergut 45 Prozent der Gesamtfläche<br />
Hart<strong>aus</strong> e<strong>in</strong>.<br />
6. Das Rittergut mit se<strong>in</strong>en Dreschgärtnern<br />
Die Flurkarte zeigt zwei Rittergüter <strong>in</strong> Hartau, die das Bauernland an der West- und<br />
Ostseite des Dorfes e<strong>in</strong>rahmen: im Osten das Schloß- oder Niedervorwerk mit dem<br />
kle<strong>in</strong>en Vorwerk und im Westen das Obervorwerk. Beide Vorwerke waren nach dem<br />
Schöffenbuch schon 1582 vorhanden. Bereits bei dem Auskauf der Bauerngüter wurde<br />
erwähnt, daß das Obervorwerk im Vergleich zum Niedervorwerk jüngeren Datums<br />
se<strong>in</strong> muß. Hier am Westende des Dorfes haben wir die sogenannten Überscharäcker zu<br />
suchen, die wir als Anfang der Vorwerksflächen anzunehmen haben. Vermutlich entstand<br />
dann <strong>aus</strong> <strong>aus</strong>gekauften Bauerngütern <strong>in</strong> der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts<br />
das Obervorwerk.<br />
Von etwa 1680 bis 1710 bildete das Obervorwerk mit e<strong>in</strong>em Teil der Hartauer Untertanen<br />
e<strong>in</strong>en besonderen Dorfteil. Beide Teile gehörten zu dieser Zeit den von Haugwitz,<br />
die ihren Wohnsitz mit "Ober-Hartau" und "Nieder-Hartau" bezeichneten. Darüber<br />
wird im Abschnitt über die Grundherren mehr gesagt werden.<br />
Das Niedervorwerk ist <strong>aus</strong> dem alten Allod (d.h. Eigenbesitz) hervorgegangen, das um<br />
1305 <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Größe von 4 Hufen erwähnt wird. Dieses Allod dürfte auf slawischen<br />
Ursprung zurückgehen, wenn auch dafür jeder urkundliche Beweis fehlt. Die Tatsache,<br />
daß hier <strong>in</strong> diesem Dorfteil die meisten "kle<strong>in</strong>en Stellen" lagen, ist noch ke<strong>in</strong> Beweis für<br />
slawischen Ursprung. Das auf Kosten des Bauernlandes wachsende Rittergut brauchte<br />
Gutsarbeiter und setzte daher Dreschgärtnerstellen an. Diese Stellen hatten um das<br />
H<strong>aus</strong> 1 bis 2 Morgen Land, durften mit der Herde des Rittergutes 2-3 Kühe mitgehen<br />
lassen und waren an der Gutsernte anteilmäßig beteiligt. Sämtliche Dreschgärtner zusammen<br />
ernteten die W<strong>in</strong>terung um die 11. und die Sommerung um die 10. Garbe (d.h.<br />
jede 10. bzw. 11. Puppe fuhren die Gärtner <strong>in</strong> ihre eigenen Scheunen) und druschen mit<br />
den Flegeln um den 20. Scheffel.<br />
Zum Obervorwerk gehörten 1743 6, zum Niedervorwerk 12 Dreschgärtner. Ihre Stellen<br />
lagen im Ober- oder Niederdorfe am Rande des Rittergutslandes. Im Mitteldorfe gab es<br />
außerdem noch 5 Mittelgärtner. Diese waren ursprünglich von Bauerngütern <strong>aus</strong>gesetzt<br />
worden (<strong>in</strong> den meisten Fällen an überzählige Söhne). Diese Gärtner mußten auf dem<br />
Bauerngute arbeiten bzw. Grundz<strong>in</strong>s zahlen und durften Kühe mit auf die Weide schicken.<br />
Im Laufe der Zeit wirkten sich diese Gärtner als Belastungen der Bauernhöfe <strong>aus</strong>, und<br />
der betreffende Bauer war später froh, daß der Gärtner auf dem Rittergut als Dreschgärtner<br />
angenommen wurde. In Hartau hatte z.B. das Weidnergut (Nr. 6) schon 1488<br />
zwei derartige Gärtnerstellen. Nach dem Dreißigjährigen Kriege kam es zwischen dem<br />
Bauern Weidner und den beiden Gärtnern zu Streitigkeiten. Gemäß e<strong>in</strong>em zu Metschlau<br />
am 12.8.1666 vollzogenen Vertrage trat Weidner beide Gärtner dem Rittergut ab. Die<br />
Gärtner mußten nunmehr "e<strong>in</strong> jedweder wie e<strong>in</strong> andrer Großgärtner se<strong>in</strong>e Dienste und<br />
Schuldigkeit verrichten" und dem Rittergute Z<strong>in</strong>s zahlen. H<strong>in</strong>gegen wurde das Weidnergut<br />
von dem Kuhgang der beiden Gärtnerstellen befreit. Diese mußten den "Heugang"<br />
14<br />
Rezeß vom 14.8.1857 im Amtsgericht Sprottau, Grundakten des Rg. Hartau, Vol. IV, f. 91-121. Von den 1600 Rtl. Kaufgeld für<br />
die halbe Hufe zahlte das Rittergut nur 516 Rtl. Den Rest trugen 11 Bauerngüter als Ablösung der gutsherrlichen Schafrechte.<br />
Die Abtretung der e<strong>in</strong>zelnen Flächen geschah meist 1854/55 teilweise, schon 1849 und 1852.<br />
16