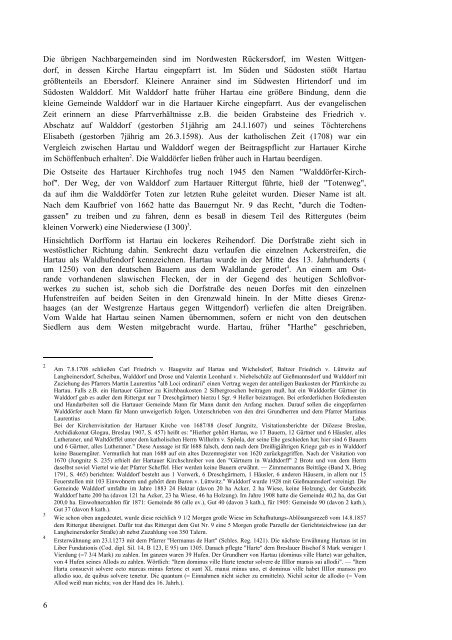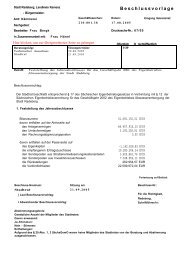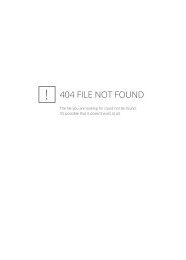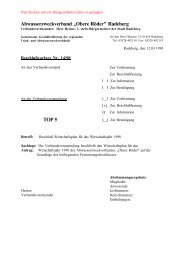Zwei Dorfstudien aus Westschlesien - Familie Spiegel in Radeberg
Zwei Dorfstudien aus Westschlesien - Familie Spiegel in Radeberg
Zwei Dorfstudien aus Westschlesien - Familie Spiegel in Radeberg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die übrigen Nachbargeme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d im Nordwesten Rückersdorf, im Westen Wittgendorf,<br />
<strong>in</strong> dessen Kirche Hartau e<strong>in</strong>gepfarrt ist. Im Süden und Südosten stößt Hartau<br />
größtenteils an Ebersdorf. Kle<strong>in</strong>ere Anra<strong>in</strong>er s<strong>in</strong>d im Südwesten Hirtendorf und im<br />
Südosten Walddorf. Mit Walddorf hatte früher Hartau e<strong>in</strong>e größere B<strong>in</strong>dung, denn die<br />
kle<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de Walddorf war <strong>in</strong> die Hartauer Kirche e<strong>in</strong>gepfarrt. Aus der evangelischen<br />
Zeit er<strong>in</strong>nern an diese Pfarrverhältnisse z.B. die beiden Grabste<strong>in</strong>e des Friedrich v.<br />
Abschatz auf Walddorf (gestorben 51jährig am 24.l.1607) und se<strong>in</strong>es Töchterchens<br />
Elisabeth (gestorben 7jährig am 26.3.1598). Aus der katholischen Zeit (1708) war e<strong>in</strong><br />
Vergleich zwischen Hartau und Walddorf wegen der Beitragspflicht zur Hartauer Kirche<br />
im Schöffenbuch erhalten 2 . Die Walddörfer ließen früher auch <strong>in</strong> Hartau beerdigen.<br />
Die Ostseite des Hartauer Kirchhofes trug noch 1945 den Namen "Walddörfer-Kirchhof".<br />
Der Weg, der von Walddorf zum Hartauer Rittergut führte, hieß der "Totenweg",<br />
da auf ihm die Walddörfer Toten zur letzten Ruhe geleitet wurden. Dieser Name ist alt.<br />
Nach dem Kaufbrief von 1662 hatte das Bauerngut Nr. 9 das Recht, "durch die Todtengassen"<br />
zu treiben und zu fahren, denn es besaß <strong>in</strong> diesem Teil des Rittergutes (beim<br />
kle<strong>in</strong>en Vorwerk) e<strong>in</strong>e Niederwiese (I 300) 3 .<br />
H<strong>in</strong>sichtlich Dorfform ist Hartau e<strong>in</strong> lockeres Reihendorf. Die Dorfstraße zieht sich <strong>in</strong><br />
westöstlicher Richtung dah<strong>in</strong>. Senkrecht dazu verlaufen die e<strong>in</strong>zelnen Ackerstreifen, die<br />
Hartau als Waldhufendorf kennzeichnen. Hartau wurde <strong>in</strong> der Mitte des 13. Jahrhunderts (<br />
um 1250) von den deutschen Bauern <strong>aus</strong> dem Waldlande gerodet 4 . An e<strong>in</strong>em am Ostrande<br />
vorhandenen slawischen Flecken, der <strong>in</strong> der Gegend des heutigen Schloßvorwerkes<br />
zu suchen ist, schob sich die Dorfstraße des neuen Dorfes mit den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Hufenstreifen auf beiden Seiten <strong>in</strong> den Grenzwald h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>. In der Mitte dieses Grenzhaages<br />
(an der Westgrenze Hart<strong>aus</strong> gegen Wittgendorf) verliefen die alten Dreigräben.<br />
Vom Walde hat Hartau se<strong>in</strong>en Namen übernommen, sofern er nicht von den deutschen<br />
Siedlern <strong>aus</strong> dem Westen mitgebracht wurde. Hartau, früher "Harthe" geschrieben,<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Am 7.8.1708 schließen Carl Friedrich v. Haugwitz auf Hartau und Wichelsdorf, Baltzer Friedrich v. Lüttwitz auf<br />
Langhe<strong>in</strong>ersdorf, Scheibau, Walddorf und Drose und Valent<strong>in</strong> Leonhard v. Niebelschülz auf Gießmannsdorf und Walddorf mit<br />
Zuziehung des Pfarrers Mart<strong>in</strong> Laurentius "alß Loci ord<strong>in</strong>arii" e<strong>in</strong>en Vertrag wegen der anteiligen Baukosten der Pfarrkirche zu<br />
Hartau. Falls z.B. e<strong>in</strong> Hartauer Gärtner zu Kirchbaukosten 2 Silbergroschen beitragen muß, hat e<strong>in</strong> Walddorfer Gärtner (<strong>in</strong><br />
Walddorf gab es außer dem Rittergut nur 7 Dreschgärtner) hierzu l Sgr. 9 Heller beizutragen. Bei erforderlichen Hofediensten<br />
und Handarbeiten soll die Hartauer Geme<strong>in</strong>de Mann für Mann damit den Anfang machen. Darauf sollen die e<strong>in</strong>gepfarrten<br />
Walddörfer auch Mann für Mann unweigerlich folgen. Unterschrieben von den drei Grundherren und dem Pfarrer Mart<strong>in</strong>us<br />
Laurentius<br />
Labe.<br />
Bei der Kirchenvisitation der Hartauer Kirche von 1687/88 (Josef Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau,<br />
Archidiakonat Glogau, Breslau 1907, S. 457) heißt es: "Hierher gehört Hartau, wo 17 Bauern, 12 Gärtner und 6 Häusler, alles<br />
Lutheraner, und Waltdörffel unter dem katholischen Herrn Wilhelm v. Spönla, der se<strong>in</strong>e Ehe geschieden hat; hier s<strong>in</strong>d 6 Bauern<br />
und 6 Gärtner, alles Lutheraner." Diese Aussage ist für l688 falsch, denn nach dem Dreißigjährigen Kriege gab es <strong>in</strong> Walddorf<br />
ke<strong>in</strong>e Bauerngüter. Vermutlich hat man 1688 auf e<strong>in</strong> altes Dezemregister von 1620 zurückgegriffen. Nach der Visitation von<br />
1670 (Jungnitz S. 235) erhielt der Hartauer Kirchschreiber von den "Gärtnern <strong>in</strong> Waldtdorff" 2 Brote und von dem Herrn<br />
daselbst soviel Viertel wie der Pfarrer Scheffel. Hier werden ke<strong>in</strong>e Bauern erwähnt. — Zimmermanns Beiträge (Band X, Brieg<br />
1791, S. 465) berichten: Walddorf besteht <strong>aus</strong> 1 Vorwerk, 6 Dreschgärtnern, 1 Häusler, 6 anderen Häusern, <strong>in</strong> allem nur 15<br />
Feuerstellen mit 103 E<strong>in</strong>wohnern und gehört dem Baron v. Lüttwitz." Walddorf wurde 1928 mit Gießmannsdorf vere<strong>in</strong>igt. Die<br />
Geme<strong>in</strong>de Walddorf umfaßte im Jahre 1883 24 Hektar (davon 20 ha Acker, 2 ha Wiese, ke<strong>in</strong>e Holzung), der Gutsbezirk<br />
Walddorf hatte 200 ha (davon 121 ha Acker, 23 ha Wiese, 46 ha Holzung). Im Jahre 1908 hatte die Geme<strong>in</strong>de 40,2 ha, das Gut<br />
200,0 ha. E<strong>in</strong>wohnerzahlen für 1871: Geme<strong>in</strong>de 86 (alle ev.), Gut 40 (davon 3 kath.), für 1905: Geme<strong>in</strong>de 90 (davon 2 kath.),<br />
Gut 37 (davon 8 kath.).<br />
Wie schon oben angedeutet, wurde diese reichlich 9 1/2 Morgen große Wiese im Schafhutungs-Ablösungsrezeß vom 14.8.1857<br />
dem Rittergut übereignet. Dafür trat das Rittergut dem Gut Nr. 9 e<strong>in</strong>e 5 Morgen große Parzelle der Gerichtsteichwiese (an der<br />
Langhe<strong>in</strong>ersdorfer Straße) ab nebst Zuzahlung von 350 Talern.<br />
Ersterwähnung am 23.l.1273 mit dem Pfarrer "Hermanus de Hart" (Schles. Reg. 1421). Die nächste Erwähnung Hart<strong>aus</strong> ist im<br />
Liber Fundationis (Cod. dipl. Sil. 14, B 123, E 95) um 1305. Danach pflegte "Harte" dem Breslauer Bischof 8 Mark weniger 1<br />
Vierdung (=7 3/4 Mark) zu zahlen. Im ganzen waren 39 Hufen. Der Grundherr von Hartau (dom<strong>in</strong>us ville Harte) war gehalten,<br />
von 4 Hufen se<strong>in</strong>es Allods zu zahlen. Wörtlich: "Item dom<strong>in</strong>us ville Harte tenetur solvere de IIIIor mansis sui allodii". — "Item<br />
Harta consuevit solvere octo marcas m<strong>in</strong>us fertonc et sunt XL mansi m<strong>in</strong>us uno, et dom<strong>in</strong>us ville habet IIIIor mansos pro<br />
allodio suo, de quibus solvere tenetur. Dic quantum (= E<strong>in</strong>nahmen nicht sicher zu ermitteln). Nichil scitur de allodio (= Vom<br />
Allod weiß man nichts; von der Hand des 16. Jahrh.).<br />
6