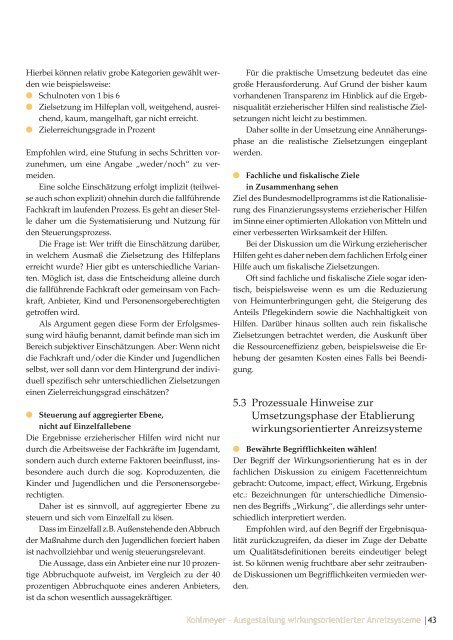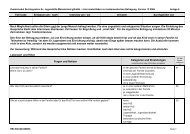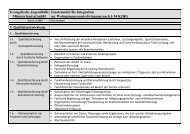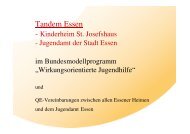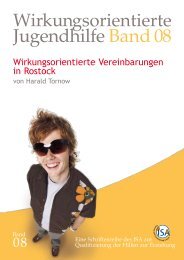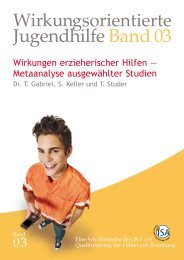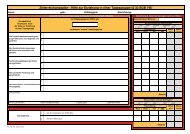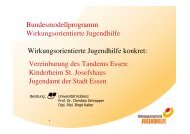Jugendhilfe Band 07 - Wirkungsorientierte Jugendhilfe
Jugendhilfe Band 07 - Wirkungsorientierte Jugendhilfe
Jugendhilfe Band 07 - Wirkungsorientierte Jugendhilfe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Hierbei können relativ grobe Kategorien gewählt werden<br />
wie beispielsweise:<br />
●● Schulnoten von 1 bis 6<br />
●● Zielsetzung im Hilfeplan voll, weitgehend, ausreichend,<br />
kaum, mangelhaft, gar nicht erreicht.<br />
●● Zielerreichungsgrade in Prozent<br />
Empfohlen wird, eine Stufung in sechs Schritten vorzunehmen,<br />
um eine Angabe „weder/noch“ zu vermeiden.<br />
Eine solche Einschätzung erfolgt implizit (teilweise<br />
auch schon explizit) ohnehin durch die fallführende<br />
Fachkraft im laufenden Prozess. Es geht an dieser Stelle<br />
daher um die Systematisierung und Nutzung für<br />
den Steuerungsprozess.<br />
Die Frage ist: Wer trifft die Einschätzung darüber,<br />
in welchem Ausmaß die Zielsetzung des Hilfeplans<br />
erreicht wurde? Hier gibt es unterschiedliche Varianten.<br />
Möglich ist, dass die Entscheidung alleine durch<br />
die fallführende Fachkraft oder gemeinsam von Fachkraft,<br />
Anbieter, Kind und Personensorgeberechtigten<br />
getroffen wird.<br />
Als Argument gegen diese Form der Erfolgsmessung<br />
wird häufig benannt, damit befinde man sich im<br />
Bereich subjektiver Einschätzungen. Aber: Wenn nicht<br />
die Fachkraft und/oder die Kinder und Jugendlichen<br />
selbst, wer soll dann vor dem Hintergrund der individuell<br />
spezifisch sehr unterschiedlichen Zielsetzungen<br />
einen Zielerreichungsgrad einschätzen?<br />
●● Steuerung auf aggregierter Ebene,<br />
nicht auf Einzelfallebene<br />
Die Ergebnisse erzieherischer Hilfen wird nicht nur<br />
durch die Arbeitsweise der Fachkräfte im Jugendamt,<br />
sondern auch durch externe Faktoren beeinflusst, insbesondere<br />
auch durch die sog. Koproduzenten, die<br />
Kinder und Jugendlichen und die Personensorgeberechtigten.<br />
Daher ist es sinnvoll, auf aggregierter Ebene zu<br />
steuern und sich vom Einzelfall zu lösen.<br />
Dass im Einzelfall z.B. Außenstehende den Abbruch<br />
der Maßnahme durch den Jugendlichen forciert haben<br />
ist nachvollziehbar und wenig steuerungsrelevant.<br />
Die Aussage, dass ein Anbieter eine nur 10 prozentige<br />
Abbruchquote aufweist, im Vergleich zu der 40<br />
prozentigen Abbruchquote eines anderen Anbieters,<br />
ist da schon wesentlich aussagekräftiger.<br />
Für die praktische Umsetzung bedeutet das eine<br />
große Herausforderung. Auf Grund der bisher kaum<br />
vorhandenen Transparenz im Hinblick auf die Ergebnisqualität<br />
erzieherischer Hilfen sind realistische Zielsetzungen<br />
nicht leicht zu bestimmen.<br />
Daher sollte in der Umsetzung eine Annäherungsphase<br />
an die realistische Zielsetzungen eingeplant<br />
werden.<br />
●● Fachliche und fiskalische Ziele<br />
in Zusammenhang sehen<br />
Ziel des Bundesmodellprogramms ist die Rationalisierung<br />
des Finanzierungssystems erzieherischer Hilfen<br />
im Sinne einer optimierten Allokation von Mitteln und<br />
einer verbesserten Wirksamkeit der Hilfen.<br />
Bei der Diskussion um die Wirkung erzieherischer<br />
Hilfen geht es daher neben dem fachlichen Erfolg einer<br />
Hilfe auch um fiskalische Zielsetzungen.<br />
Oft sind fachliche und fiskalische Ziele sogar identisch,<br />
beispielsweise wenn es um die Reduzierung<br />
von Heimunterbringungen geht, die Steigerung des<br />
Anteils Pflegekindern sowie die Nachhaltigkeit von<br />
Hilfen. Darüber hinaus sollten auch rein fiskalische<br />
Zielsetzungen betrachtet werden, die Auskunft über<br />
die Ressourceneffizienz geben, beispielsweise die Erhebung<br />
der gesamten Kosten eines Falls bei Beendigung.<br />
5.3 Prozessuale Hinweise zur<br />
Umsetzungsphase der Etablierung<br />
wirkungsorientierter Anreizsysteme<br />
●● Bewährte Begrifflichkeiten wählen!<br />
Der Begriff der Wirkungsorientierung hat es in der<br />
fachlichen Diskussion zu einigem Facettenreichtum<br />
gebracht: Outcome, impact, effect, Wirkung, Ergebnis<br />
etc.: Bezeichnungen für unterschiedliche Dimensionen<br />
des Begriffs „Wirkung“, die allerdings sehr unterschiedlich<br />
interpretiert werden.<br />
Empfohlen wird, auf den Begriff der Ergebnisqualität<br />
zurückzugreifen, da dieser im Zuge der Debatte<br />
um Qualitätsdefinitionen bereits eindeutiger belegt<br />
ist. So können wenig fruchtbare aber sehr zeitraubende<br />
Diskussionen um Begrifflichkeiten vermieden werden.<br />
Kohlmeyer – Ausgestaltung wirkungsorientierter Anreizsysteme | 43