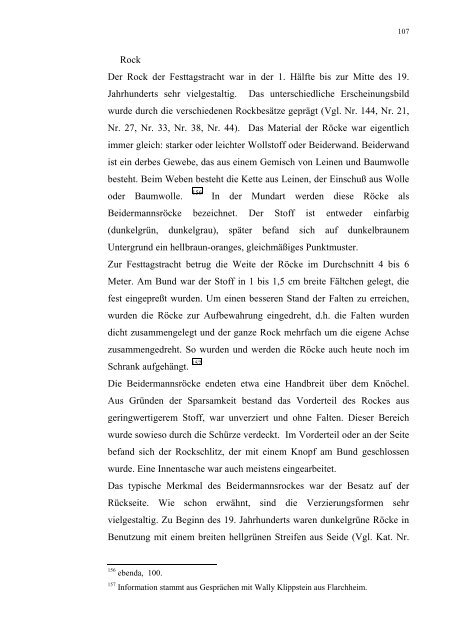3.5. Kirchgangstracht (Mitte bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
3.5. Kirchgangstracht (Mitte bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
3.5. Kirchgangstracht (Mitte bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Rock<br />
Der Rock der Festtagstracht war in der 1. <strong>Hälfte</strong> <strong>bis</strong> zur <strong>Mitte</strong> <strong>des</strong> <strong>19.</strong><br />
<strong>Jahrhunderts</strong> sehr vielgestaltig. Das unterschiedliche Erscheinungsbild<br />
wurde durch die verschiedenen Rockbesätze geprägt (Vgl. Nr. 144, Nr. 21,<br />
Nr. 27, Nr. 33, Nr. 38, Nr. 44). Das Material der Röcke war eigentlich<br />
immer gleich: starker oder leichter Wollstoff oder Beiderwand. Beiderwand<br />
ist ein derbes Gewebe, das aus einem Gemisch von Leinen und Baumwolle<br />
besteht. Beim Weben besteht die Kette aus Leinen, der Einschuß aus Wolle<br />
156<br />
oder Baumwolle. In der Mundart werden diese Röcke als<br />
Beidermannsröcke bezeichnet. Der Stoff ist entweder einfarbig<br />
(dunkelgrün, dunkelgrau), später befand sich auf dunkelbraunem<br />
Untergrund ein hellbraun-oranges, gleichmäßiges Punktmuster.<br />
Zur Festtagstracht betrug die Weite der Röcke im Durchschnitt 4 <strong>bis</strong> 6<br />
Meter. Am Bund war der Stoff in 1 <strong>bis</strong> 1,5 cm breite Fältchen gelegt, die<br />
fest eingepreßt wurden. Um einen besseren Stand der Falten zu erreichen,<br />
wurden die Röcke zur Aufbewahrung eingedreht, d.h. die Falten wurden<br />
dicht zusammengelegt und der ganze Rock mehrfach um die eigene Achse<br />
zusammengedreht. So wurden und werden die Röcke auch heute noch im<br />
Schrank aufgehängt. 157<br />
Die Beidermannsröcke endeten etwa eine Handbreit über dem Knöchel.<br />
Aus Gründen der Sparsamkeit bestand das Vorderteil <strong>des</strong> Rockes aus<br />
geringwertigerem Stoff, war unverziert und ohne Falten. Dieser Bereich<br />
wurde sowieso durch die Schürze verdeckt. Im Vorderteil oder an der Seite<br />
befand sich der Rockschlitz, der mit einem Knopf am Bund geschlossen<br />
wurde. Eine Innentasche war auch meistens eingearbeitet.<br />
Das typische Merkmal <strong>des</strong> Beidermannsrockes war der Besatz auf der<br />
Rückseite. Wie schon erwähnt, sind die Verzierungsformen sehr<br />
vielgestaltig. Zu Beginn <strong>des</strong> <strong>19.</strong> <strong>Jahrhunderts</strong> waren dunkelgrüne Röcke in<br />
Benutzung mit einem breiten hellgrünen Streifen aus Seide (Vgl. Kat. Nr.<br />
156<br />
ebenda, 100.<br />
157<br />
Information stammt aus Gesprächen mit Wally Klippstein aus Flarchheim.<br />
107