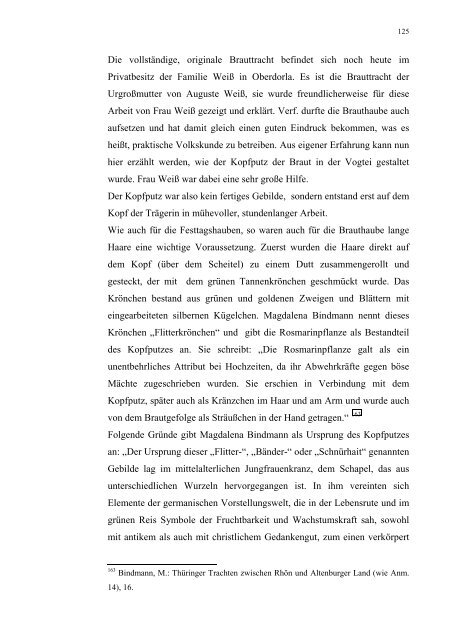3.5. Kirchgangstracht (Mitte bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
3.5. Kirchgangstracht (Mitte bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
3.5. Kirchgangstracht (Mitte bis 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts)
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die vollständige, originale Brauttracht befindet sich noch heute im<br />
Privatbesitz der Familie Weiß in Oberdorla. Es ist die Brauttracht der<br />
Urgroßmutter von Auguste Weiß, sie wurde freundlicherweise für diese<br />
Arbeit von Frau Weiß gezeigt und erklärt. Verf. durfte die Brauthaube auch<br />
aufsetzen und hat damit gleich einen guten Eindruck bekommen, was es<br />
heißt, praktische Volkskunde zu betreiben. Aus eigener Erfahrung kann nun<br />
hier erzählt werden, wie der Kopfputz der Braut in der Vogtei gestaltet<br />
wurde. Frau Weiß war dabei eine sehr große Hilfe.<br />
Der Kopfputz war also kein fertiges Gebilde, sondern entstand erst auf dem<br />
Kopf der Trägerin in mühevoller, stundenlanger Arbeit.<br />
Wie auch für die Festtagshauben, so waren auch für die Brauthaube lange<br />
Haare eine wichtige Voraussetzung. Zuerst wurden die Haare direkt auf<br />
dem Kopf (über dem Scheitel) zu einem Dutt zusammengerollt und<br />
gesteckt, der mit dem grünen Tannenkrönchen geschmückt wurde. Das<br />
Krönchen bestand aus grünen und goldenen Zweigen und Blättern mit<br />
eingearbeiteten silbernen Kügelchen. Magdalena Bindmann nennt dieses<br />
Krönchen „Flitterkrönchen“ und gibt die Rosmarinpflanze als Bestandteil<br />
<strong>des</strong> Kopfputzes an. Sie schreibt: „Die Rosmarinpflanze galt als ein<br />
unentbehrliches Attribut bei Hochzeiten, da ihr Abwehrkräfte gegen böse<br />
Mächte zugeschrieben wurden. Sie erschien in Verbindung mit dem<br />
Kopfputz, später auch als Kränzchen im Haar und am Arm und wurde auch<br />
von dem Brautgefolge als Sträußchen in der Hand getragen.“ 163<br />
Folgende Gründe gibt Magdalena Bindmann als Ursprung <strong>des</strong> Kopfputzes<br />
an: „Der Ursprung dieser „Flitter-“, „Bänder-“ oder „Schnürhait“ genannten<br />
Gebilde lag im mittelalterlichen Jungfrauenkranz, dem Schapel, das aus<br />
unterschiedlichen Wurzeln hervorgegangen ist. In ihm vereinten sich<br />
Elemente der germanischen Vorstellungswelt, die in der Lebensrute und im<br />
grünen Reis Symbole der Fruchtbarkeit und Wachstumskraft sah, sowohl<br />
mit antikem als auch mit christlichem Gedankengut, zum einen verkörpert<br />
163 Bindmann, M.: Thüringer Trachten zwischen Rhön und Altenburger Land (wie Anm.<br />
14), 16.<br />
125