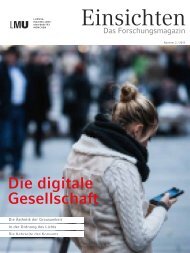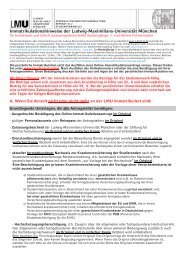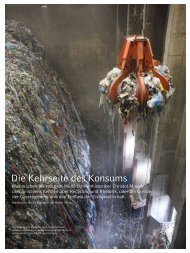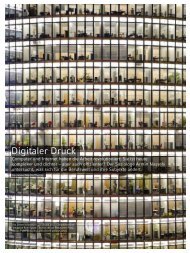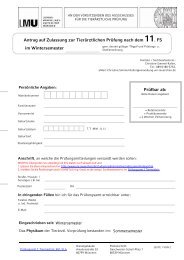MünchnerUni Magazin - Ludwig-Maximilians-Universität München
MünchnerUni Magazin - Ludwig-Maximilians-Universität München
MünchnerUni Magazin - Ludwig-Maximilians-Universität München
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zum letzten Punkt ein Beispiel aus der Befragung: „Geisteswissenschaftliche<br />
Sachverhalte und Problemstellungen sind so eng an die<br />
Sprache gebunden, dass die alleinige Dominanz des Englischen zu<br />
einem Verlust an Wissen, Problembewusstsein, Vielfalt und Kommunikation<br />
führen würde.“<br />
Das Zitat thematisiert die Konstitution von Forschungsgegenständen<br />
in „nationalsprachlich geprägten“ Wissenschaften und verweist darüber<br />
hinaus auf die enge Beziehung zwischen Sprache als Mittel der<br />
Erkenntnis in einer Wissenschaft und der Kommunikation der Erkenntnis<br />
in eben dieser Sprache.<br />
EnGlISCh – lInGUa fRanCa DER WElTWEITEn<br />
WISSEnSChafTSkoMMUnIkaTIon?<br />
Unter einer Lingua franca wird ein sekundär erworbenes Sprachsystem<br />
verstanden, das als Kommunikationsmittel zwischen Sprechern<br />
verschiedener Muttersprachen dient. Gemäß diesem allgemein akzeptierten<br />
Verständnis einer Lingua franca erscheint es nicht gerechtfertigt,<br />
von Englisch als Lingua franca in den Wissenschaften zu sprechen,<br />
es sei denn, man schließt die englischen Muttersprachler aus.<br />
Zwar gibt es internationale wissenschaftliche Arbeits- und Kommunikationskontexte,<br />
die ausschließlich aus Nicht-Muttersprachlern des<br />
Englischen bestehen. Schriftliche Wissenschaftskommunikation des<br />
Englischen ohne englische Muttersprachler und ohne entsprechenden<br />
Rekurs auf die sprachlichen Normen dieser Gruppe ist im Hinblick auf<br />
die faktische Dominanz des Englischen allerdings wirklichkeitsfremd<br />
und unpraktisch.<br />
Das Konzept Englisch als Lingua franca der Wissenschaften ist auch<br />
deshalb problematisch, weil dadurch eine kommunikative Gleichheit<br />
der Sprecher und Schreiber suggeriert wird, die in der Wirklichkeit<br />
nicht vorhanden ist: Für die einen ist das Englische Erstsprache, für<br />
die anderen Zweit- oder auch Drittsprache. Auch wenn in der Diskussion<br />
des Englischen als Globalsprache alle Benutzer des Englischen<br />
zu Besitzern dieser Sprache erklärt werden („English belongs to all its<br />
users”), so klingt dies zunächst entgegenkommend, hat aber auch<br />
einen gönnerhaften Ton; denn es ist ja in der Tat nicht so, dass alle<br />
Sprachbenutzer des Englischen an der Weiterentwicklung des Englischen<br />
und seiner standardsprachlichen Kodifizierung in gleicher Weise<br />
teilhaben würden. Für den mündlichen Sprachgebrauch in der internationalen<br />
Wissenschaftskommunikation kann – je nach Gesprächskontext<br />
– durchaus von einer erheblichen Flexibilität und Normabweichung<br />
in der Sprachverwendung ausgegangen werden. Dieses gilt<br />
jedoch weniger bzw. nur in sehr eingeschränktem Umfang für die<br />
schriftliche, standardbasierte Wissenschaftskommunikation, da angesehene<br />
amerikanische und britische Verlage sowie englisch-muttersprachliche<br />
Herausgeber als „gatekeepers“ über sprachliche Korrektheit<br />
wachen. Deshalb ist es rationaler, diese prinzipielle Ungleichheit<br />
zwischen Muttersprachlern und Nicht-Muttersprachlern des Englischen<br />
anzuerkennen, als sie zu ignorieren oder gar aus Gründen vermeintlicher<br />
political correctness so zu tun, als ob jedem das Englische<br />
genau so leicht falle wie die Muttersprache.<br />
PERSPEkTIvEn<br />
Erst das offene Eingeständnis der besonderen Herausforderungen<br />
durch die englische Sprache, vor allem in der schriftlichen Wissenschaftskommunikation,<br />
schafft das Bewusstsein dafür, dass Wissenschaftlern,<br />
Studierenden und nicht-wissenschaftlichem Personal entsprechende<br />
Unterstützung in den Hochschulen durch einen englischen<br />
Sprachservice geboten werden sollte. Ein solcher Sprachservice könnte<br />
für Wissenschaftler und fortgeschrittene Studierende wirkungsvolle<br />
Hilfe bzw. Starthilfe bei der Abfassung und Korrektur von englischsprachigen<br />
Manuskripten leisten sowie Übersetzungsdienste anbieten.<br />
Des Weiteren sollte ein angemessenes Angebot englischer<br />
Sprachkurse, zum mündlichen und zum geschriebenen Englisch sowie<br />
zur schriftlichen Fachkommunikation, für alle Statusgruppen der <strong>Universität</strong><br />
zur Verfügung stehen. Die Fokussierung auf das Englische darf<br />
allerdings nicht in den weniger anglophonen und durch die Nationalsprachen<br />
geprägten Wissenschaften, wie z. B. den Geistes-, Erziehungs-<br />
oder Rechtswissenschaften, den Blick für Mehrsprachigkeit<br />
und für Multiperspektivität der Forschung versperren. Da die Fähigkeit<br />
einer differenzierten und nuancierten Ausdrucksweise den allermeisten<br />
Sprachbenutzern nur in der Erstsprache gegeben ist, sollte insbesondere<br />
in solchen Disziplinen, deren Forschungsgegenstände eng<br />
mit der Sprache und Kultur eines Landes verbunden sind, die (wissenschafts-)politisch<br />
immer stärker forcierte Forderung, das Englische<br />
generell als Wissenschaftssprache zum Nachweis von internationaler<br />
Reputation zu gebrauchen, sicherlich aufgegeben werden. Es sollten<br />
darüber hinaus Möglichkeiten bereitgestellt werden, qualitativ herausragende<br />
Arbeiten für die Autoren kostenfrei ins Englische zu übersetzen.<br />
Andererseits ist nicht zu verleugnen, dass in vielen ‚kulturunabhängigen‘<br />
Wissenschaftsbereichen wie den Naturwissenschaften<br />
ausschließlich auf Englisch publiziert wird, sodass eine Nichtbefolgung<br />
dieses Modus zu einer Überlebensfrage im Sinne der Titelfrage<br />
würde. Eine ‚dogmatische‘, d. h. durch die Kommunikationssituation<br />
nicht zu rechtfertigende Verwendung des Englischen in der mündlichen<br />
Kommunikation, etwa wenn alle Teilnehmer des Deutschen<br />
mächtig sind, sollte jedoch vermieden werden. Der Vorschlag, eine für<br />
die weltweite Wissenschaftskommunikation neue, nicht-muttersprachlich<br />
basierte Varietät des Englischen wie „Globalish“ oder „Globalesisch“<br />
zu entwickeln, mag rhetorisch verlockend klingen, ist aber<br />
faktisch unrealistisch, da er die Beziehung von Sprache, Kultur und<br />
(politischer) Macht ausblendet. Die Tatsache, dass auch China sich<br />
dem Englischlernen verschrieben hat und die Beherrschung des Englischen<br />
dort als wichtige Kompetenz für Studium und Beruf gilt, lässt<br />
erkennen, dass die Vorrangstellung des Englischen als Welt- und Wissenschaftssprache<br />
für die nächsten Jahrzehnte unangefochten ist.<br />
Ammon, Ulrich. „Ist Deutsch noch internationale Wissenschaftssprache?<br />
Englisch auch für die Lehre an den deutschsprachigen Hochschulen.“<br />
Berlin; New York: de Gruyter 1998.<br />
Gnutzmann, Claus (ed.) „English in Academia. Catalyst or Barrier?“<br />
Tübingen: Narr 2008.<br />
Gnutzmann, Claus; Intemann, Frauke; Janßen, Hero; Nübold, Peter. „Die englische Sprache<br />
in Studium, Wissenschaft und Verwaltung – Ergebnisse einer Online-Umfrage“.<br />
Fachsprache/International Journal of LSP 26 (2004), 1-2, 14-34.<br />
MUM 01 | 2010 ESSay<br />
9