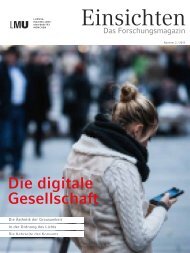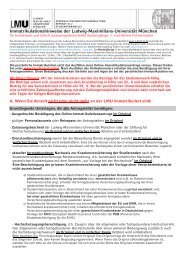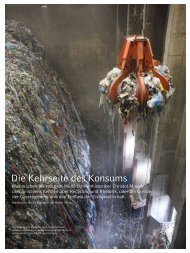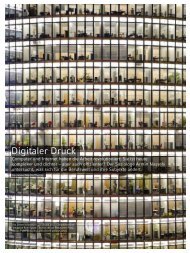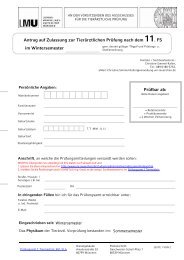MünchnerUni Magazin - Ludwig-Maximilians-Universität München
MünchnerUni Magazin - Ludwig-Maximilians-Universität München
MünchnerUni Magazin - Ludwig-Maximilians-Universität München
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2<br />
1<br />
UMFragE „WiE PräSENt iSt ENgLiSch<br />
iN ihrEM UNiaLLtag?“<br />
Der Biologe Benjamin haßfurth (1) arbeitet an der Graduate School<br />
of Systemic Neurosciences der LMU auf den Titel „Doctor of Philosophy<br />
(PhD)“ hin: „Zu Beginn meines Biologiegrundstudiums spielte<br />
Englisch nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das hat sich enorm<br />
geändert – bei Vorlesungen in den internationalen Masterstudiengängen<br />
und natürlich in wissenschaftlichen Vorträgen sowie Seminaren.<br />
Gerade jetzt arbeiten wir an einer Veröffentlichung – natürlich<br />
für ein englischsprachiges <strong>Magazin</strong>. Wenn mir für einen Gedankengang<br />
in deutscher Sprache mal keine befriedigende Übersetzung<br />
einfällt, diskutiere ich darüber mit meiner australischen Kollegin am<br />
Nebentisch. Auch privat wird oft Englisch gesprochen, bei Grillfeiern<br />
oder im Biergarten. Englisch ist, zumindest in der Biologie, universell<br />
akzeptiert – und diese Tatsache würde es mir auch erleichtern,<br />
überall auf der Welt einen Postdoc zu machen, ohne die jeweilige<br />
Landessprache zu beherrschen.“<br />
Marina Schweizer (2) absolviert den Masterstudiengang Kommunikationswissenschaften<br />
an der LMU: „In der Uni hatte ich noch<br />
nie einen Kurs auf Englisch. Man braucht es höchstens einmal für<br />
englischsprachige Fachliteratur, aber selbst Studenten, die aus dem<br />
Ausland kommen, sprechen alle Deutsch, und man unterhält sich mit<br />
ihnen nicht auf Englisch. Sie müssen ja auch Deutsch können, bei uns<br />
gibt es schließlich keine Chance, das Studium in irgendeiner Weise<br />
auf Englisch zu machen. Wenn man bei Industrieunternehmen oder<br />
PR-Agenturen arbeitet, ist gutes Englisch Pflicht. Vor allem während<br />
meines Bachelorstudiums habe ich dort mein Englisch oft ausgepackt.<br />
Jetzt arbeite ich journalistisch. Da ist außer Deutsch eigentlich<br />
keine andere Sprache relevant. Davor, während der Schulzeit, war<br />
ich einmal ein Jahr in den USA und habe dort nach wie vor viele<br />
Freunde. Deshalb ist es für mich absolut kein Problem, mich auf<br />
Englisch auszudrücken. Mein Sprachniveau ist allerdings durch die<br />
Highschool wenig akademisch.“<br />
Professor Paula-irene villa (3) hat den Lehrstuhl Allgemeine Soziologie/Gender<br />
Studies am Institut für Soziologie inne: „Englisch ist<br />
meine zweite Muttersprache – ich bin unter anderem in den USA<br />
und Kanada aufgewachsen. Auch im Forschungskontext höre, lese<br />
und spreche ich viel und sehr gern Englisch. Dabei ist es in meinem<br />
Unialltag gar nicht übermäßig präsent: In der Fachliteratur der Lehre<br />
etwa zu 30 Prozent, bei mündlichen Prüfungen zu circa zehn Prozent<br />
– etwa beim Master „Psychology of Excellence“. Gastvorträge<br />
auf Englisch finden in unserem Fach zwar eher selten statt. Jedoch<br />
3<br />
4<br />
kommuniziere ich quasi täglich mit Kollegen und Kolleginnen aus<br />
den USA oder Kanada, aus den Niederlanden und Großbritannien.<br />
Englischsprachige Publikationen lese ich im Original – wie bei der<br />
Theoretikerin Judith Butler. Mir wäre es recht, wenn noch weitaus<br />
mehr auf Englisch kommuniziert würde. Die Bemühungen um den<br />
Erhalt von Deutsch als Wissenschaftssprache, kann ich nicht nachvollziehen.<br />
Gerade deutsche Studierende tun sich schwer, unverkrampft<br />
auf Englisch zu sprechen oder nur zu lesen. Dahinter steht<br />
die – falsche – Annahme, eine Sprache ,perfekt’ sprechen zu müssen.<br />
Außerhalb Deutschlands beziehungsweise Europas setzt man in der<br />
Wissenschaft eher auf pragmatische Verständigung.“<br />
Bastian hauser (4) studiert Philosophie mit den Nebenfächern Politikwissenschaften<br />
und VWL: „In Philosophie ist mir bisher kaum<br />
Englisches begegnet, mal abgesehen von ein paar Fachbegriffen in<br />
Logik, die aber auch eher beiläufig eingestreut wurden. In Politik<br />
kommt es sehr auf das betreffende Teilfach an, in Politischer Theorie<br />
gibt es zum Beispiel viele Texte auf Deutsch, in den Fächern<br />
Politische Systeme und Internationale Beziehungen spielt sich fast<br />
alles auf Englisch ab, Texte und Zeitschriften auf Deutsch gibt es, wie<br />
bestimmt auch in den meisten anderen Gesellschaftswissenschaften,<br />
kaum. In VWL ist es ähnlich, hier gibt es auch Vorlesungen, die auf<br />
Englisch gehalten werden, was ich aus meinen anderen Fächern<br />
nicht kannte. Bisher bereitete mir das alles glücklicherweise keine<br />
größeren Probleme.“<br />
Saraswati L. (5) studiert im neunten Semester Medizin an der LMU<br />
und besucht den Fachsprachkurs Medilingua: „Nach einer Famulatur<br />
in einem Krankenhaus in Kanada bin ich im Englischen einigermaßen<br />
geübt. In meinem Münchner Unialltag kommt Englisch aber eigentlich<br />
gar nicht so oft vor; die Vorlesungen sind alle auf Deutsch, ich<br />
habe nur ein Pathologiebuch auf Englisch. Bei der Doktorarbeit –<br />
mein Thema ist Nephrologie, akutes Nierenversagen – dagegen sehr.<br />
Da hat man es beim Recherchieren fast ausschließlich mit englischen<br />
Texten zu tun. Zudem arbeiten bei mir im Labor zum Beispiel einige<br />
Inder, und mit ihnen unterhalte ich mich natürlich auf Englisch.<br />
Die medizinischen Fachbegriffe sind dabei das geringste Problem.<br />
Ob Nephrologie oder Nephrology, die Worte unterscheiden sich ja<br />
kaum.“<br />
5<br />
MUM 01 | 2010 titEL<br />
7