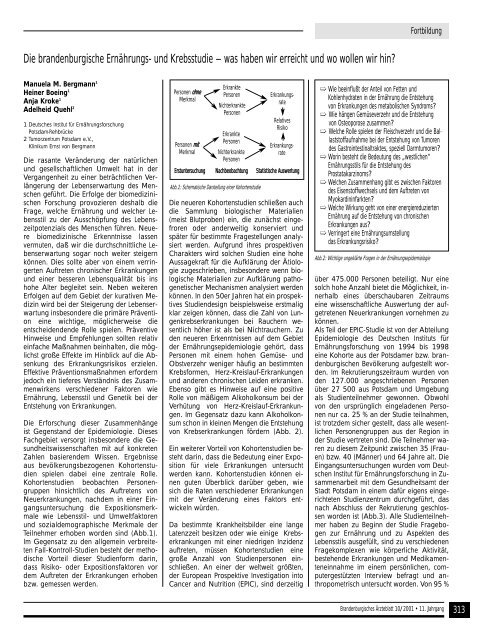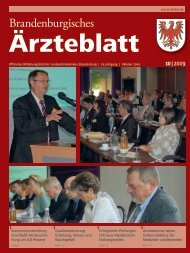Ãrzteblatt - qs- nrw
Ãrzteblatt - qs- nrw
Ãrzteblatt - qs- nrw
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fortbildung<br />
Die brandenburgische Ernährungs- und Krebsstudie – was haben wir erreicht und wo wollen wir hin<br />
Manuela M. Bergmann 1<br />
Heiner Boeing 1<br />
Anja Kroke 1<br />
Adelheid Quehl 2<br />
1 Deutsches Institut für Ernährungsforschung<br />
Potsdam-Rehbrücke<br />
2 Tumorzentrum Potsdam e.V.,<br />
Klinikum Ernst von Bergmann<br />
Die rasante Veränderung der natürlichen<br />
und gesellschaftlichen Umwelt hat in der<br />
Vergangenheit zu einer beträchtlichen Verlängerung<br />
der Lebenserwartung des Menschen<br />
geführt. Die Erfolge der biomedizinischen<br />
Forschung provozieren deshalb die<br />
Frage, welche Ernährung und welcher Lebensstil<br />
zu der Ausschöpfung des Lebenszeitpotenzials<br />
des Menschen führen. Neuere<br />
biomedizinische Erkenntnisse lassen<br />
vermuten, daß wir die durchschnittliche Lebenserwartung<br />
sogar noch weiter steigern<br />
können. Dies sollte aber von einem verringerten<br />
Auftreten chronischer Erkrankungen<br />
und einer besseren Lebensqualität bis ins<br />
hohe Alter begleitet sein. Neben weiteren<br />
Erfolgen auf dem Gebiet der kurativen Medizin<br />
wird bei der Steigerung der Lebenserwartung<br />
insbesondere die primäre Prävention<br />
eine wichtige, möglicherweise die<br />
entscheidendende Rolle spielen. Präventive<br />
Hinweise und Empfehlungen sollten relativ<br />
einfache Maßnahmen beinhalten, die möglichst<br />
große Effekte im Hinblick auf die Absenkung<br />
des Erkrankungsrisikos erzielen.<br />
Effektive Präventionsmaßnahmen erfordern<br />
jedoch ein tieferes Verständnis des Zusammenwirkens<br />
verschiedener Faktoren wie<br />
Ernährung, Lebensstil und Genetik bei der<br />
Entstehung von Erkrankungen.<br />
Die Erforschung dieser Zusammenhänge<br />
ist Gegenstand der Epidemiologie. Dieses<br />
Fachgebiet versorgt insbesondere die Gesundheitswissenschaften<br />
mit auf konkreten<br />
Zahlen basierendem Wissen. Ergebnisse<br />
aus bevölkerungsbezogenen Kohortenstudien<br />
spielen dabei eine zentrale Rolle.<br />
Kohortenstudien beobachten Personengruppen<br />
hinsichtlich des Auftretens von<br />
Neuerkrankungen, nachdem in einer Eingangsuntersuchung<br />
die Expositionsmerkmale<br />
wie Lebensstil- und Umweltfaktoren<br />
und sozialdemographische Merkmale der<br />
Teilnehmer erhoben worden sind (Abb.1).<br />
Im Gegensatz zu den allgemein verbreiteten<br />
Fall-Kontroll-Studien besteht der methodische<br />
Vorteil dieser Studienform darin,<br />
dass Risiko- oder Expositionsfaktoren vor<br />
dem Auftreten der Erkrankungen erhoben<br />
bzw. gemessen werden.<br />
Personen ohne<br />
Merkmal<br />
Personen mit<br />
Merkmal<br />
Erkrankte<br />
Personen<br />
Nichterkrankte<br />
Personen<br />
Erkrankte<br />
Personen<br />
Nichterkrankte<br />
Personen<br />
Abb.1: Schematische Darstellung einer Kohortenstudie<br />
Relatives<br />
Risiko<br />
Erkrankungsrate<br />
Erkrankungsrate<br />
Erstuntersuchung Nachbeobachtung Statistische Auswertung<br />
Die neueren Kohortenstudien schließen auch<br />
die Sammlung biologischer Materialien<br />
(meist Blutproben) ein, die zunächst eingefroren<br />
oder anderweitig konserviert und<br />
später für bestimmte Fragestellungen analysiert<br />
werden. Aufgrund ihres prospektiven<br />
Charakters wird solchen Studien eine hohe<br />
Aussagekraft für die Aufklärung der Ätiologie<br />
zugeschrieben, insbesondere wenn biologische<br />
Materialien zur Aufklärung pathogenetischer<br />
Mechanismen analysiert werden<br />
können. In den 50er Jahren hat ein prospektives<br />
Studiendesign beispielsweise erstmalig<br />
klar zeigen können, dass die Zahl von Lungenkrebserkrankungen<br />
bei Rauchern wesentlich<br />
höher ist als bei Nichtrauchern. Zu<br />
den neueren Erkenntnissen auf dem Gebiet<br />
der Ernährungsepidemiologie gehört, dass<br />
Personen mit einem hohen Gemüse- und<br />
Obstverzehr weniger häufig an bestimmten<br />
Krebsformen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen<br />
und anderen chronischen Leiden erkranken.<br />
Ebenso gibt es Hinweise auf eine positive<br />
Rolle von mäßigem Alkoholkonsum bei der<br />
Verhütung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.<br />
Im Gegensatz dazu kann Alkoholkonsum<br />
schon in kleinen Mengen die Entstehung<br />
von Krebserkrankungen fördern (Abb. 2).<br />
Ein weiterer Vorteil von Kohortenstudien besteht<br />
darin, dass die Bedeutung einer Exposition<br />
für viele Erkrankungen untersucht<br />
werden kann. Kohortenstudien können einen<br />
guten Überblick darüber geben, wie<br />
sich die Raten verschiedener Erkrankungen<br />
mit der Veränderung eines Faktors entwickeln<br />
würden.<br />
Da bestimmte Krankheitsbilder eine lange<br />
Latenzzeit besitzen oder wie einige Krebserkrankungen<br />
mit einer niedrigen Inzidenz<br />
auftreten, müssen Kohortenstudien eine<br />
große Anzahl von Studienpersonen einschließen.<br />
An einer der weltweit größten,<br />
der European Prospektive Investigation into<br />
Cancer and Nutrition (EPIC), sind derzeitig<br />
➯ Wie beeinflußt der Anteil von Fetten und<br />
Kohlenhydraten in der Ernährung die Entstehung<br />
von Erkrankungen des metabolischen Syndroms<br />
➯ Wie hängen Gemüseverzehr und die Entstehung<br />
von Osteoporose zusammen<br />
➯ Welche Rolle spielen der Fleischverzehr und die Ballaststoffaufnahme<br />
bei der Entstehung von Tumoren<br />
des Gastrointestinaltraktes, speziell Darmtumoren<br />
➯ Worin besteht die Bedeutung des „westlichen“<br />
Ernährungsstils für die Entstehung des<br />
Prostatakarzinoms<br />
➯ Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Faktoren<br />
des Eisenstoffwechsels und dem Auftreten von<br />
Myokardininfarkten<br />
➯ Welche Wirkung geht von einer energiereduzierten<br />
Ernährung auf die Entstehung von chronischen<br />
Erkrankungen aus<br />
➯ Verringert eine Ernährungsumstellung<br />
das Erkrankungsrisiko<br />
Abb.2: Wichtige ungeklärte Fragen in der Ernährungsepidemiologie<br />
über 475.000 Personen beteiligt. Nur eine<br />
solch hohe Anzahl bietet die Möglichkeit, innerhalb<br />
eines überschaubaren Zeitraums<br />
eine wissenschaftliche Auswertung der aufgetretenen<br />
Neuerkrankungen vornehmen zu<br />
können.<br />
Als Teil der EPIC-Studie ist von der Abteilung<br />
Epidemiologie des Deutschen Instituts für<br />
Ernährungsforschung von 1994 bis 1998<br />
eine Kohorte aus der Potsdamer bzw. brandenburgischen<br />
Bevölkerung aufgestellt worden.<br />
Im Rekrutierungszeitraum wurden von<br />
den 127.000 angeschriebenen Personen<br />
über 27 500 aus Potsdam und Umgebung<br />
als Studienteilnehmer gewonnen. Obwohl<br />
von den ursprünglich eingeladenen Personen<br />
nur ca. 25 % an der Studie teilnahmen,<br />
ist trotzdem sicher gestellt, dass alle wesentlichen<br />
Personengruppen aus der Region in<br />
der Studie vertreten sind. Die Teilnehmer waren<br />
zu diesem Zeitpunkt zwischen 35 (Frauen)<br />
bzw. 40 (Männer) und 64 Jahre alt. Die<br />
Eingangsuntersuchungen wurden vom Deutschen<br />
Institut für Ernährungsforschung in Zusammenarbeit<br />
mit dem Gesundheitsamt der<br />
Stadt Potsdam in einem dafür eigens eingerichteten<br />
Studienzentrum durchgeführt, das<br />
nach Abschluss der Rekrutierung geschlossen<br />
worden ist (Abb.3). Alle Studienteilnehmer<br />
haben zu Beginn der Studie Fragebogen<br />
zur Ernährung und zu Aspekten des<br />
Lebensstils ausgefüllt, sind zu verschiedenen<br />
Fragekomplexen wie körperliche Aktivität,<br />
bestehende Erkrankungen und Medikamenteneinnahme<br />
im einem persönlichen, computergestützten<br />
Interview befragt und anthropometrisch<br />
untersucht worden. Von 95 %<br />
Brandenburgisches Ärzteblatt 10/2001 • 11. Jahrgang<br />
313