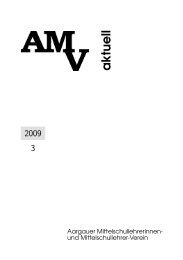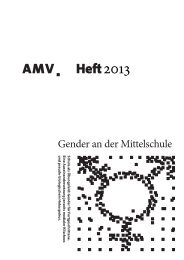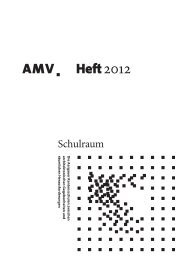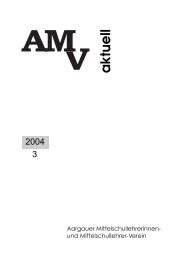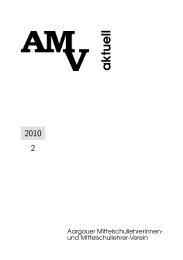Schulkonkurrenz â wozu? - AMV
Schulkonkurrenz â wozu? - AMV
Schulkonkurrenz â wozu? - AMV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>AMV</strong>-aktuell Sonderheft 06/1 23<br />
schen Ländern die allgemeine,<br />
staatlich unterhaltene Volksschule<br />
aufgebaut, nachdem man<br />
erkannt hatte, dass gleiche Bildung<br />
für alle zur Staatsaufgabe<br />
gehört. Während aber Verschulung,<br />
gerade im Elementarbereich,<br />
zu Beginn ohne Privatanbieter<br />
unmöglich war, gingen<br />
diese am Ende des 19. Jahrhundert<br />
ein, da der Staat für Anforderungen<br />
und Ausstattungen der<br />
öffentlichen Schulen sorgte, die<br />
jede vorhandene Konkurrenz<br />
überforderte. […]<br />
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />
gab es erneut eine Gründungswelle<br />
von Privatschulen, die wesentlicher<br />
professioneller und<br />
marketingbewusster verlief als<br />
die individuellen Gründungen des<br />
19. Jahrhunderts. Im deutschen<br />
Sprachraum hiessen diese<br />
Schulen „Landerziehungsheime“<br />
und stellten eine eigene Marke<br />
dar. Das Produkt nutzte eine<br />
kritische Stimmung vor allem von<br />
unzufriedenen Eltern, die mit<br />
dem staatlichen Angebot insbesondere<br />
im Bereich der Höheren<br />
Bildung nicht einverstanden waren.<br />
Sie wollten sich die Bildung<br />
aussuchen, die sie für ihre Kinder<br />
als geeignet ansahen. […]<br />
Ende der zwanziger Jahre waren<br />
es hunderte von Schulen für sehr<br />
verschiedene Bildungsbedürfnisse,<br />
die eine regelrechte Produktpalette<br />
darstellten. Aber es waren<br />
Nischenprodukte, die wohl<br />
ihren eigenen, bis heute anhaltenden<br />
Nimbus aufbauten – man<br />
denke an die Steiner-Schulen –,<br />
die aber nie eine Konkurrenz zur<br />
staatlichen Bildungsversorgung<br />
darstellten. Die Träger waren<br />
junge, oft enthusiastische Bildungsunternehmer,<br />
die mit grossem<br />
öffentlichem Beifall rechnen<br />
konnten, ohne sich in irgendeinem<br />
nennenswerten Massstab<br />
durchsetzen zu können. Die kostenlose<br />
Bildungsversorgung aus<br />
Steuermitteln war weitaus attraktiver,<br />
zudem stieg die Qualität<br />
der öffentlichen Schulen, verbesserte<br />
sich die Verwertbarkeit der<br />
Abschlüsse und gewöhnte sich<br />
die Gesellschaft an ein paternales<br />
System, das vorschreibt und<br />
einklagt, was öffentliche Bildung<br />
sein soll.<br />
Diese historische Erfahrung ist<br />
grundlegend: Nur öffentliche<br />
Schulen waren imstande, für<br />
einen gleich bleibenden Anstieg<br />
der Bildungsqualität zu sorgen,<br />
ohne grössere Schwankungen in<br />
Kauf zu nehmen, mit wachsenden<br />
Budgetsicherheiten und<br />
spätestens seit Ende des 19.<br />
Jahrhunderts als gesellschaftlich<br />
akzeptierte Institution.<br />
Diese Gewähr scheint zu Ende<br />
zu gehen, wenn nicht die reale<br />
Schulentwicklung betrachtet wird,<br />
sondern Expertendiskussionen,<br />
die Argumente und Daten für<br />
einen Systemwechsel bereitstellen.<br />
Der Ansatzpunkt ist ein ökonomischer<br />
Verdacht: Wer immer<br />
mehr Geld für Bildung verlangt,<br />
erzeugt keine höhere Qualität<br />
und erst recht keinen Wandel<br />
des Systems, sondern immer<br />
more of the same. Investitionen<br />
in öffentliche Bildung sind daher<br />
gleichbedeutend mit Verschwendung,<br />
weil sie ein Fass ohne<br />
Boden beträfen, das nur ein Interesse<br />
habe, nämlich die Zufuhr<br />
öffentlicher Gelder unkontrolliert<br />
zu halten und zu steigern (HA-<br />
NUSHEK 1981).<br />
Der Ausgangspunkt dieser Diskussion<br />
sind amerikanische Krisenszenarien,<br />
in denen der ständige<br />
Niedergang der Bildungsleistungen<br />
mit der ständigen Erhöhung<br />
der zur Verfügung gestellten<br />
öffentlichen Mittel konfrontiert<br />
wurde. Diese Diskussion führt die<br />
amerikanische Öffentlichkeit seit<br />
Mitte des 19. Jahrhunderts periodisch,<br />
ohne die zentralen Dualismen<br />
auflösen zu können. Die<br />
letzte grosse Diskussion begann<br />
in den frühen achtziger Jahren<br />
des 20. Jahrhunderts und erreichte<br />
zehn Jahre später einen<br />
ersten Höhepunkt, als die Geduld<br />
mit schlechten staatlichen Schulen<br />
zu Ende zu gehen schien.<br />
1990 erschien eine sehr einflussreiche<br />
Publikation, die den provozierenden<br />
Titel trug: Politics,<br />
Markets, and America’s Schools<br />
(CHUBB/MOE 1990).<br />
Unmittelbar nach Erscheinen war<br />
das Buch der Mittelpunkt einer<br />
aufgeregten Diskussion, die mit<br />
ihren wesentlichen Argumenten<br />
inzwischen auch Kontinentaleuropa<br />
erreicht hat. Die Thesen des<br />
Buches beziehen sich auf einen<br />
Negativbefund:<br />
Die amerikanischen Schulen<br />
sind über Gebühr bürokratisch<br />
und über Gebühr politisch<br />
(ebd., S. 26).<br />
Sie legen fest, was und wie<br />
gelernt werden soll, ohne dabei<br />
Abnehmerinteressen in<br />
Rechnung stellen zu müssen,<br />
und sie entschieden darüber<br />
mit politischer Macht, die die<br />
Freiheit sowohl der Eltern als<br />
auch der Kinder massiv einschränkt.<br />
Eltern und Kinder – also die<br />
Kunden des Systems – haben<br />
keine Mitsprache bei der Gestaltung<br />
der Lehrpläne, entscheiden<br />
nicht über die Lehrmittel,<br />
haben kaum Einflussnahme<br />
auf Lehreranstellungen<br />
und können vor allem<br />
auch nicht wählen, welche<br />
Schule für sie in Frage kommt<br />
und welche nicht.<br />
Sie entscheiden daher nicht<br />
nach Angebot, sondern bekommen<br />
Bildung zugeteilt.<br />
Bürokratie regelt möglichst gleich<br />
und begrenzt die Unterschiede.<br />
Weil aber Schulen nur dann gut<br />
sind, wenn sie einzigartig sind,<br />
schliessen CHUBB und MOE,<br />
dürfen und können sie nicht politisch<br />
verwaltet werden.<br />
„Bureaucracy is a clumsy and<br />
ineffective way of providing<br />
people with educational services”<br />
(ebd.).<br />
Die Bürokratie diene den politischen<br />
Zielen, für die sie eingesetzt<br />
wurde. Die amerikanische<br />
progressive Bewegung, also die<br />
liberale Politik der Demokraten<br />
und ihrer Interessengruppen,<br />
habe auf diesem schulpolitischen<br />
Wege ihre Macht zementiert und<br />
so andere von der Beteiligung<br />
ausgeschlossen. Diese Theorie<br />
ist grundlegend, um zu verstehen,<br />
warum Bildungsmärkte eine