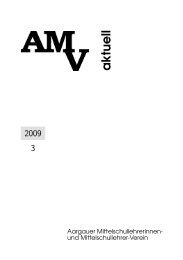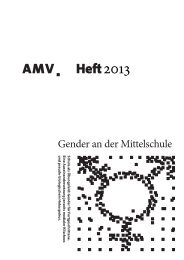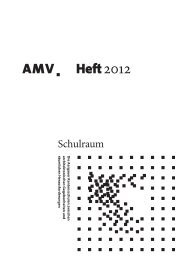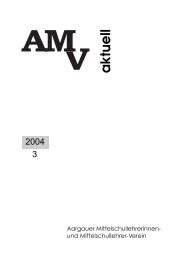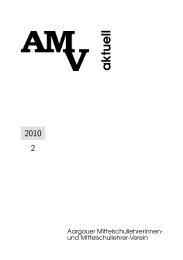Schulkonkurrenz â wozu? - AMV
Schulkonkurrenz â wozu? - AMV
Schulkonkurrenz â wozu? - AMV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>AMV</strong>-aktuell Sonderheft 06/1 29<br />
Die Freiheit der Schulwahl führt<br />
sofort zur Frage, was Eltern entscheiden<br />
sollen und können,<br />
wenn sie die „beste Bildung für<br />
ihr Kind” wählen. In einem nennenswerten<br />
Sinne könnte überhaupt<br />
nur dann gewählt werden,<br />
wenn es zwischen den Schulen<br />
grosse und erkennbare Unterschiede<br />
im Angebot gäbe. Aber<br />
öffentliche Schulen vollziehen<br />
identische Aufträge und sind im<br />
Blick auf ihre Angebote keineswegs<br />
„autonom”. Wenn sich<br />
Qualität der Schulen unterscheidet,<br />
was zu erwarten ist, würde<br />
das nicht dazu berechtigen, die<br />
schlechtere Schule zu benachteiligen,<br />
was eine freigesetzte<br />
Schulwahl, die Ranglisten von<br />
„gut” und “schlecht” zur Verfügung<br />
hat, sofort bewirken würde.<br />
Die schlechtere Schule erfüllt<br />
keinen anderen Auftrag als die<br />
bessere. Evaluationsdaten, die<br />
auf eine schlechtere Qualität<br />
verweisen, können also, angesichts<br />
des gemeinsamen Auftrages,<br />
nur der Anlass sein, für Verbesserungen<br />
zu sorgen. Schwächen<br />
müssen ausgeglichen werden,<br />
während das Marktmodell<br />
den Verlust der Lizenz vorsieht,<br />
wenn eine minimale Nachfrage<br />
unterschritten wird.<br />
Das hätte zwei missliche Konsequenzen:<br />
Bei gleicher Gesamtschülerzahl<br />
müssten stark nachgefragte<br />
Schulen einen Numerus<br />
Clausus einführen, der ihre Qualität<br />
schützen soll und dadurch<br />
andere Anbieter benachteiligt;<br />
gleichzeitig begrenzt die Finanzierung<br />
durch Nachfrage diesen<br />
Selbstschutz, weil die Mittel nach<br />
dem Schüleraufkommen und so<br />
den Elternwahlen verteilt werden.<br />
Gute Schulen würden sich durch<br />
einen strikten Numerus Clausus<br />
schützen und schädigen:<br />
Wenn sie ihre Schülerzahl<br />
begrenzen, verzichten sie auf<br />
Mittel, die aus ihrer Attraktivität<br />
für Eltern erwachsen;<br />
wenn sie die Schülerzahl mit<br />
der Nachfrage ausweiten, bedrohen<br />
sie ihre Qualität, die<br />
der Grund ist für die Nachfrage.<br />
Gerade einzelne, erfolgreiche<br />
Schulen kommen also in Schwierigkeiten,<br />
wenn wirklich die Elternwahl<br />
freigesetzt wird und die<br />
Wahl sich nach Rangskalen von<br />
„gut” und „schlecht” ausrichten.<br />
5. Ausblick auf die Entwicklung<br />
der öffentlichen Bildung<br />
[…] Die Idee der freien Schulwahl<br />
und der Einführung von<br />
Bildungsgutscheinen ist, wenigstens<br />
in der Literatur, populärer<br />
denn je. Sie hat, ohne grosse<br />
Untersuchung der gescheiterten<br />
amerikanischen Kampagnen, die<br />
Schweiz erreicht, mit Argumenten,<br />
die sämtlich auf HAYEK und<br />
FRIEDMAN zurückzuführen sind<br />
und die erneut der Schlüsselfrage<br />
ausweichen, ob und wenn ja,<br />
wie öffentliche Güter mit Marktmodellen<br />
in Verbindung gebracht<br />
werden können, ohne dass die<br />
allgemeine Bildung der Bürgerinnen<br />
und Bürger einen Schaden<br />
erleidet. Der Markt müsste es<br />
besser machen, aber das liesse<br />
sich erst nach der Systementscheidung<br />
feststellen. Wer diesen<br />
Wechsel ernsthaft wünscht,<br />
muss eine Risikoanalyse in Auftrag<br />
geben.<br />
Freilich, eine weitreichende Privatisierung<br />
des Bildungssystems<br />
hat bislang in den Vereinigten<br />
Staaten ebenso wenig stattgefunden<br />
wie die komplette Umstellung<br />
der Bildungsfinanzierung<br />
auf Vouchers (so noch eine starke<br />
Programmatik am Ende der<br />
REAGAN-Administration: LIE-<br />
BERMAN 1989). Auf der anderen<br />
Seite werden die öffentlichen<br />
Haushalte eng, die Mittel verknappen<br />
sich, das Bildungssystem<br />
kann nicht ewig mit Zuwachs<br />
rechnen. Die staatliche<br />
Finanzierung, wie immer sie organisiert<br />
werden mag, kann nicht<br />
jeden irgendwie berechtigten<br />
Bildungswunsch unterstützen,<br />
sondern muss sich auf Kernaufgaben<br />
beschränken, was deswegen<br />
schwer fällt, weil sich die<br />
eigentlichen „Kunden” des Bildungssystems,<br />
also die Schüler,<br />
längst daran gewöhnt haben,<br />
eine Shopping Mall vor sich zu<br />
sehen (so die Kritik Mitte der<br />
achtziger Jahre: PO-<br />
WELL/FERRAR/COHEN 1985).<br />
Die neuere theoretische Kritik an<br />
Marktmodellen in der Bildung<br />
greift auf die klassische Nationalökonomie<br />
zurück 11 und minimiert<br />
oder marginalisiert die beiden<br />
neoliberalen Alternativen,<br />
nämlich die Human-Capital- und<br />
die Rational-Choice-Theorie.<br />
Eine allgemeine Bildung, die an<br />
öffentlichen Gütern (public<br />
goods) orientiert ist, also die<br />
nicht einfach von Abschlüssen<br />
Gewinne erwartet, sondern von<br />
Lernen Effekte für Bürgerinnen<br />
und Bürger, lässt sich nicht<br />
marktförmig organisieren, weil<br />
und soweit Märkte nur Gewinne<br />
oder Verluste für Individuen –<br />
Personen oder Unternehmen –<br />
regeln (WINCH 1996, S. 110f.).<br />
Wer keine öffentlichen Güter<br />
anerkennt, kann auch keine öffentlichen<br />
Unternehmungen anerkennen<br />
und so aber auch keine<br />
öffentlichen Wahlen (STRET-<br />
TON/ORCHARD 1994). Allgemeinbildende<br />
Schulen sind aber<br />
nicht anders als mit öffentlichen<br />
Gütern zu begründen. Bedürfnisse<br />
von Kindern, die die Eltern<br />
definieren, sind kein hinreichender<br />
Grund, das bisherige System<br />
umzustellen, was umgekehrt<br />
aber auch nicht heissen kann,<br />
zwischen einzelnen Schulen<br />
gravierende Qualitätsunterschiede<br />
in Kauf nehmen zu müssen.<br />
Das Lernen muss nachweislich<br />
mit öffentlichen Gütern verknüpft<br />
werden, anders ist die exklusive<br />
Zuständigkeit der Schule ernsthaft<br />
bedroht. Die Grenzen der<br />
Marktmetapher (HENIG 1994)<br />
lassen sich nur empirisch zeigen,<br />
während auf der anderen Seite<br />
immer genügend kritisches Potential<br />
vorhanden ist, die tatsächlichen<br />
Leistungen der Schule,<br />
11 Gemeint ist der Teil III “Of the Expence<br />
of Public Works and public Institutions”<br />
im fünften Buch von ADAM<br />
SMITH’ The Wealth of Nations. Ich folge<br />
der Deutung von OSTERWALDER<br />
(1993)