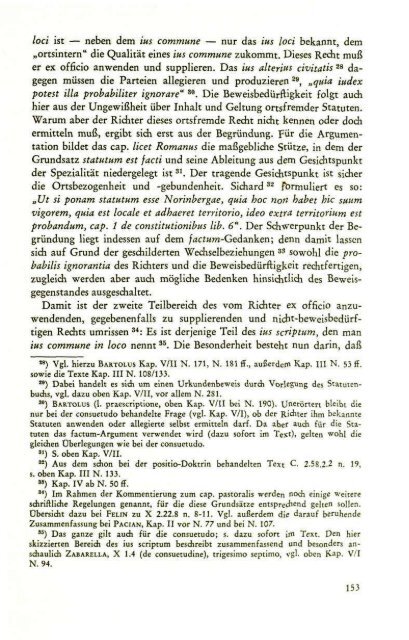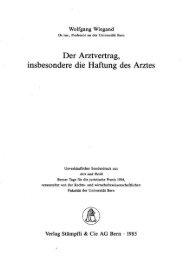141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
loci ist — neben dem ius commune — nur das ius loci bekannt, dem<br />
„ortsintern" die Qualität eines ius commune zukommt. Dieses Redit muß<br />
er ex officio anwenden und supplieren. Das ius alterius civitatis 2 « dagegen<br />
müssen die Parteien allegieren und produzieren 29 , „quia iudex<br />
potest ilia probabiliter ignorare" 30 . Die Beweisbedürftigkeit folgt auch<br />
hier aus der Ungewißheit über Inhalt und Geltung ortsfremder Statuten.<br />
Warum aber der Richter dieses ortsfremde Recht nicht kennen oder doch<br />
ermitteln muß, ergibt sich erst aus der Begründung. Für die Argumentation<br />
bildet das cap. licet Romanus die maßgebliche Stütze, in dem der<br />
Grundsatz statutum est facti und seine Ableitung aus dem Gesichtspunkt<br />
der Spezialität niedergelegt ist 31 . Der tragende Gesichtspunkt ist sicher<br />
die Ortsbezogenheit und -gebundenheit. Sichard 32 formuliert es so:<br />
„Ut si ponam statutum esse Norinbergae, quia hoc non habet hie suum<br />
vigorem, quia est locale et adhaeret territorio, ideo extra territorium est<br />
probandum, cap. 1 de constitutionibus lib. 6". Der Schwerpunkt der Begründung<br />
liegt indessen auf dem factum-Gedanken; denn damit lassen<br />
sich auf Grund der geschilderten Wechselbeziehungen 33 sowohl die probabilis<br />
ignorantia des Richters und die Beweisbedürftigkeit rechtfertigen,<br />
zugleich werden aber auch mögliche Bedenken hinsichtlich des Beweisgegenstandes<br />
ausgeschaltet.<br />
Damit ist der zweite Teilbereich des vom Richter ex officio anzuwendenden,<br />
gegebenenfalls zu supplierenden und nicht-beweisbedürftigen<br />
Rechts umrissen 34 : Es ist derjenige Teil des ius scriptum, den man<br />
ius commune in loco nennt 35 . Die Besonderheit besteht nun darin, daß<br />
M<br />
) Vgl. hierzu BARTOLUS Kap. V/II N. 171, N. 181 ff., außerdem Kap. Ill N. 53 ff.<br />
sowie die Texte Kap. Ill N. 108/133.<br />
") Dabei handelt es sich um einen Urkundenbeweis durch Vorlegung des Statutenbuchs,<br />
vgl. dazu oben Kap. V/II, vor allem N. 281.<br />
30<br />
) BARTOLUS (1. praescriptione, oben Kap. V/II bei N. 190). Unerörtert bleibt die<br />
nur bei der consuetudo behandelte Frage (vgl. Kap. V/I), ob der Richter ihm bekannte<br />
Statuten anwenden oder allegierte selbst ermitteln darf. Da aber auch für die Statuten<br />
das factum-Argument verwendet wird (dazu sofort im Text), gelten wohl die<br />
gleichen Überlegungen wie bei der consuetudo.<br />
31<br />
) S. oben Kap. V/II.<br />
32<br />
) Aus dem schon bei der positio-Doktrin<br />
s. oben Kap. Ill N. 133.<br />
M<br />
) Kap. IV ab N. 50 ff.<br />
behandelten Text C. 2.58.2.2 n. 19,<br />
34<br />
) Im Rahmen der Kommentierung zum cap. pastoralis werden noch einige weitere<br />
schriftliche Regelungen genannt, für die diese Grundsätze entsprechend gelten sollen.<br />
Übersicht dazu bei FELIN ZU X 2.22.8 n. 8-11. Vgl. außerdem die darauf<br />
Zusammenfassung bei PACIAN, Kap. II vor N. 77 und bei N. 107.<br />
beruhende<br />
35<br />
) Das ganze gilt auch für die consuetudo; s. dazu sofort im Text. Den hier<br />
skizzierten Bereich des ius scriptum beschreibt zusammenfassend und besond e rs anschaulich<br />
ZABARELLA, X 1.4 (de consuetudine), trigesimo septimo, vgl. oben Kap. V/I<br />
N. 94.<br />
153