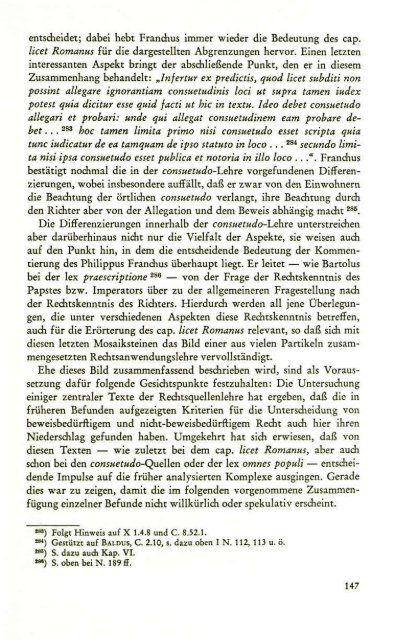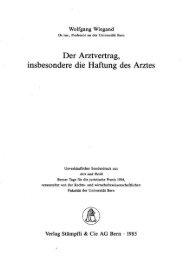141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
entscheidet; dabei hebt Franchus immer wieder die Bedeutung des cap.<br />
licet Romanus für die dargestellten Abgrenzungen hervor. Einen letzten<br />
interessanten Aspekt bringt der abschließende Punkt, den er in diesem<br />
Zusammenhang behandelt: „Infertur ex predictis, quod licet subditi non<br />
possint allegare ignorantiam consuetudinis loci ut supra tarnen iudex<br />
potest quia dicitur esse quid facti ut hie in textu. Ideo debet consuetudo<br />
allegari et probari: unde qui allegat consuetudinem earn probare debet<br />
. . . 283 hoc tarnen limita primo nisi consuetudo esset scripta quia<br />
tunc iudicatur de ea tamquam de ipso statuto in loco . . . 284 secundo limita<br />
nisi ipsa consuetudo esset publica et notoria in Mo loco . . .". Franchus<br />
bestätigt nochmal die in der consuetudo-Lehre vorgefundenen Differenzierungen,<br />
wobei insbesondere auffällt, daß er zwar von den Einwohnern<br />
die Beachtung der örtlichen consuetudo verlangt, ihre Beachtung durch<br />
den Richter aber von der Allegation und dem Beweis abhängig macht 285 .<br />
Die Differenzierungen innerhalb der consuetudo-Lehre unterstreichen<br />
aber darüberhinaus nicht nur die Vielfalt der Aspekte, sie weisen auch<br />
auf den Punkt hin, in dem die entscheidende Bedeutung der Kommentierung<br />
des Philippus Franchus überhaupt liegt. Er leitet — wie Bartolus<br />
bei der lex praescriptione 286 — von der Frage der Rechtskenntnis des<br />
Papstes bzw. Imperators über zu der allgemeineren Fragestellung nach<br />
der Rechtskenntnis des Richters. Hierdurch werden all jene Überlegungen,<br />
die unter verschiedenen Aspekten diese Rechtskenntnis betreffen,<br />
auch für die Erörterung des cap. licet Romanus relevant, so daß sich mit<br />
diesen letzten Mosaiksteinen das Bild einer aus vielen Partikeln zusammengesetzten<br />
Rechtsanwendungslehre vervollständigt.<br />
Ehe dieses Bild zusammenfassend beschrieben wird, sind als Voraussetzung<br />
dafür folgende Gesichtspunkte festzuhalten: Die Untersuchung<br />
einiger zentraler Texte der Rechtsquellenlehre hat ergeben, daß die in<br />
früheren Befunden aufgezeigten Kriterien für die Unterscheidung von<br />
beweisbedürftigem und nicht-beweisbedürftigem Recht auch hier ihren<br />
Niederschlag gefunden haben. Umgekehrt hat sich erwiesen, daß von<br />
diesen Texten — wie zuletzt bei dem cap. licet Romanus, aber auch<br />
schon bei den co«s#et«*/o-Quellen oder der lex omnes populi — entscheidende<br />
Impulse auf die früher analysierten Komplexe ausgingen. Gerade<br />
dies war zu zeigen, damit die im folgenden vorgenommene Zusammenfügung<br />
einzelner Befunde nicht willkürlich oder spekulativ erscheint.<br />
tei ) Folgt Hinweis auf X 1.4.8 und C. 8.52.1.<br />
!M ) Gestützt auf BALDUS, C. 2.10, s. dazu oben I N. 112, 113 u. ö.<br />
M5 ) S. dazu auch Kap. VI.<br />
*») S. oben bei N. 189 ff.<br />
147