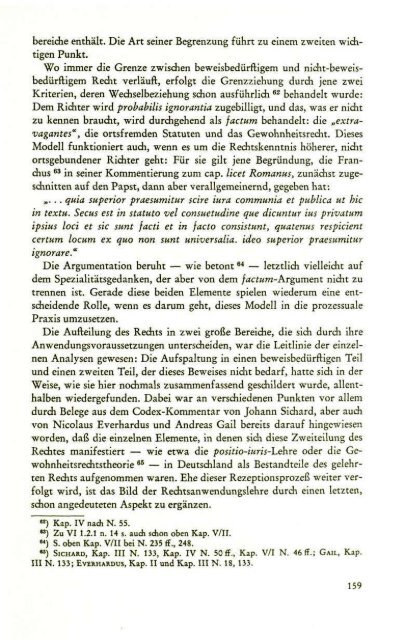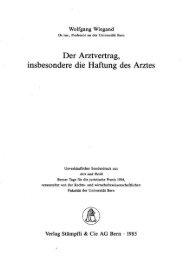141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ereidie enthält. Die Art seiner Begrenzung führt zu einem zweiten wichtigen<br />
Punkt.<br />
Wo immer die Grenze zwischen beweisbedürftigem und nicht-beweisbedürftigem<br />
Recht verläuft, erfolgt die Grenzziehung durch jene zwei<br />
Kriterien, deren Wechselbeziehung schon ausführlich 62 behandelt wurde:<br />
Dem Richter wird probabilis ignorantia zugebilligt, und das, was er nicht<br />
zu kennen braucht, wird durchgehend als factum behandelt: die „extravagantes",<br />
die ortsfremden Statuten und das Gewohnheitsrecht. Dieses<br />
Modell funktioniert auch, wenn es um die Rechtskenntnis höherer, nicht<br />
ortsgebundener Richter geht: Für sie gilt jene Begründung, die Franchus<br />
63 in seiner Kommentierung zum cap. licet Romanus, zunächst zugeschnitten<br />
auf den Papst, dann aber verallgemeinernd, gegeben hat:<br />
„. . . quia superior praesumitur scire iura communia et publica ut hic<br />
in textu. Secus est in statuto vel consuetudine que dicuntur ius privatum<br />
ipsius loci et sie sunt facti et in facto consistunt, quatenus respicient<br />
certum locum ex quo non sunt universalia. ideo superior praesumitur<br />
ignorare."<br />
Die Argumentation beruht — wie betont 64 — letztlich vielleicht auf<br />
dem Spezialitätsgedanken, der aber von dem factum-Argument nicht zu<br />
trennen ist. Gerade diese beiden Elemente spielen wiederum eine entscheidende<br />
Rolle, wenn es darum geht, dieses Modell in die prozessuale<br />
Praxis umzusetzen.<br />
Die Aufteilung des Rechts in zwei große Bereiche, die sich durch ihre<br />
Anwendungsvoraussetzungen unterscheiden, war die Leitlinie der einzelnen<br />
Analysen gewesen: Die Aufspaltung in einen beweisbedürftigen Teil<br />
und einen zweiten Teil, der dieses Beweises nicht bedarf, hatte sich in der<br />
Weise, wie sie hier nochmals zusammenfassend geschildert wurde, allenthalben<br />
wiedergefunden. Dabei war an verschiedenen Punkten vor allem<br />
durch Belege aus dem Codex-Kommentar von Johann Sichard, aber auch<br />
von Nicolaus Everhardus und Andreas Gail bereits darauf hingewiesen<br />
worden, daß die einzelnen Elemente, in denen sich diese Zweiteilung des<br />
Rechtes manifestiert — wie etwa die positio-iuris-Lehre oder die Gewohnheitsrechtstheorie<br />
65 — in Deutschland als Bestandteile des gelehrten<br />
Rechts aufgenommen waren. Ehe dieser Rezeptionsprozeß weiter verfolgt<br />
wird, ist das Bild der Rechtsanwendungslehre durch einen letzten,<br />
schon angedeuteten Aspekt zu ergänzen.<br />
«) Kap. IV nach N. 55.<br />
•») Zu VI 1.2.1 n. 14 s. auch schon oben Kap. V/II.<br />
M ) S. oben Kap. V/II bei N. 235 ff., 248.<br />
•») SICHARD, Kap. III N. 133, Kap. IV N. 50 ff., Kap. V/I N. 46 ff.; GAIL, Kap.<br />
III N. 133; EVERHARDUS, Kap. II und Kap. Ill N. 18, 133.<br />
159