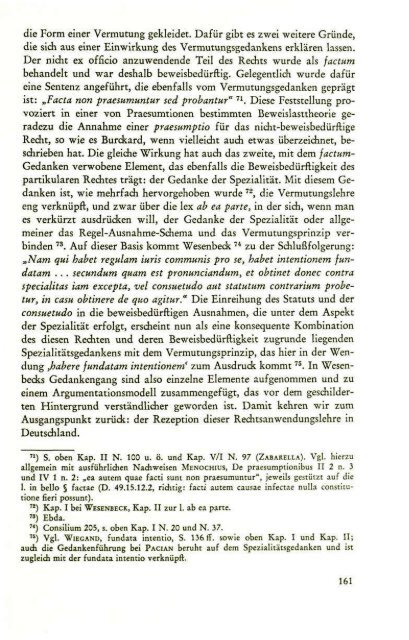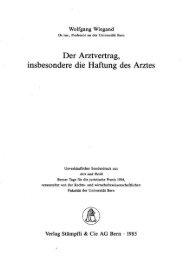141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
die Form einer Vermutung gekleidet. Dafür gibt es zwei weitere Gründe,<br />
die sich aus einer Einwirkung des Vermutungsgedankens erklären lassen.<br />
Der nicht ex officio anzuwendende Teil des Rechts wurde als factum<br />
behandelt und war deshalb beweisbedürftig. Gelegentlich wurde dafür<br />
eine Sentenz angeführt, die ebenfalls vom Vermutungsgedanken geprägt<br />
ist: „Facta non praesumuntur sed probantur" 71 . Diese Feststellung provoziert<br />
in einer von Praesumtionen bestimmten Beweislasttheorie geradezu<br />
die Annahme einer praesumptio für das nicht-beweisbedürftige<br />
Recht, so wie es Burckard, wenn vielleicht auch etwas überzeichnet, beschrieben<br />
hat. Die gleiche Wirkung hat auch das zweite, mit dem factum-<br />
Gedanken verwobene Element, das ebenfalls die Beweisbedürftigkeit des<br />
partikularen Rechtes trägt: der Gedanke der Spezialität. Mit diesem Gedanken<br />
ist, wie mehrfach hervorgehoben wurde 72 , die Vermutungslehre<br />
eng verknüpft, und zwar über die lex ab ea parte, in der sich, wenn man<br />
es verkürzt ausdrücken will, der Gedanke der Spezialität oder allgemeiner<br />
das Regel-Ausnahme-Schema und das Vermutungsprinzip verbinden<br />
73 . Auf dieser Basis kommt Wesenbeck 74 zu der Schlußfolgerung:<br />
„Nam qui habet regulam iuris communis pro se, habet intentionem fundatam<br />
. . . secundum quam est pronunciandum, et obtinet donec contra<br />
specialitas iam excepta, vel consuetudo aut statutum contrarium probetur,<br />
in casu obtinere de quo agitur." Die Einreihung des Statuts und der<br />
consuetudo in die beweisbedürftigen Ausnahmen, die unter dem Aspekt<br />
der Spezialität erfolgt, erscheint nun als eine konsequente Kombination<br />
des diesen Rechten und deren Beweisbedürftigkeit zugrunde liegenden<br />
Spezialitätsgedankens mit dem Vermutungsprinzip, das hier in der Wendung<br />
.habere fundatam intentionem' zum Ausdruck kommt 75 . In Wesenbecks<br />
Gedankengang sind also einzelne Elemente aufgenommen und zu<br />
einem Argumentationsmodell zusammengefügt, das vor dem geschilderten<br />
Hintergrund verständlicher geworden ist. Damit kehren wir zum<br />
Ausgangspunkt zurück: der Rezeption dieser Rechtsanwendungslehre in<br />
Deutschland.<br />
71<br />
) S. oben Kap. II N. 100 u. ö. und Kap. V/I N. 97 (ZABARELLA). Vgl. hierzu<br />
allgemein mit ausführlichen Nachweisen MENOCHIUS, De praesumptionibus II 2 n. 3<br />
und IV 1 n. 2: „ea autem quae facti sunt non praesumuntur", jeweils gestützt auf die<br />
1. in bello § factae (D. 49.15.12.2, richtig: facti autem causae infectae nulla constitutione<br />
fieri possunt).<br />
7!<br />
) Kap. I bei WESENBECK, Kap. II zur 1. ab ea parte.<br />
) Ebda.<br />
74<br />
) Consilium 205, s. oben Kap. I N. 20 und N. 37.<br />
,6<br />
) Vgl. WIEGAND, fundata intentio, S. 136 ff. sowie oben Kap. I und Kap. II;<br />
auch die Gedankenführung bei PACIAN beruht auf dem Spezialitätsgedanken und ist<br />
zugleich mit der fundata intentio verknüpft.<br />
161