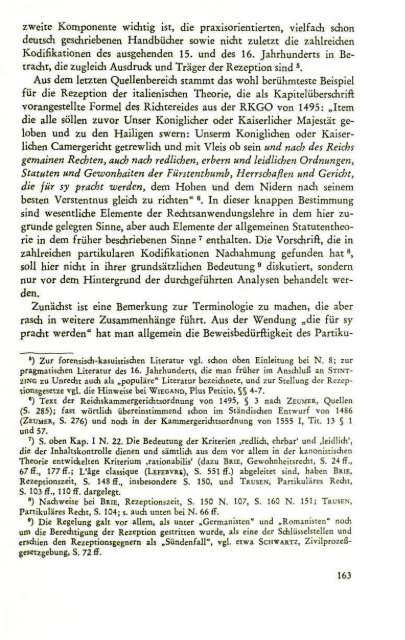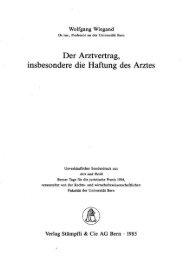141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
141-165 (4839 KB) - Wolfgang Wiegand
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
zweite Komponente wichtig ist, die praxisorientierten, vielfach schon<br />
deutsch geschriebenen Handbücher sowie nicht zuletzt die zahlreichen<br />
Kodifikationen des ausgehenden 15. und des 16. Jahrhunderts in Betracht,<br />
die zugleich Ausdruck und Träger der Rezeption sind 5 .<br />
Aus dem letzten Quellenbereich stammt das wohl berühmteste Beispiel<br />
für die Rezeption der italienischen Theorie, die als Kapitelüberschrift<br />
vorangestellte Formel des Richtereides aus der RKGO von 1495: „Item<br />
die alle sollen zuvor Unser Königlicher oder Kaiserlicher Majestät geloben<br />
und zu den Hailigen swern: Unserm Königlichen oder Kaiserlichen<br />
Camergericht getrewlich und mit Vleis ob sein und nach des Reichs<br />
gemainen Rechten, auch nach redlichen, erbern und leidlichen Ordnungen,<br />
Statuten und Gewonhaiten der Fürstenthumb, Herrschaften und Gericht,<br />
die für sy pracht werden, dem Hohen und dem Nidern nach seinem<br />
besten Verstentnus gleich zu richten" 6 . In dieser knappen Bestimmung<br />
sind wesentliche Elemente der Rechtsanwendungslehre in dem hier zugrunde<br />
gelegten Sinne, aber auch Elemente der allgemeinen Statutentheorie<br />
in dem früher beschriebenen Sinne 7 enthalten. Die Vorschrift, die in<br />
zahlreichen partikularen Kodifikationen Nachahmung gefunden hat 8 ,<br />
soll hier nicht in ihrer grundsätzlichen Bedeutung 9 diskutiert, sondern<br />
nur vor dem Hintergrund der durchgeführten Analysen behandelt werden.<br />
Zunächst ist eine Bemerkung zur Terminologie zu machen, die aber<br />
rasch in weitere Zusammenhänge führt. Aus der Wendung „die für sy<br />
pracht werden" hat man allgemein die Beweisbedürftigkeit des Partiku-<br />
6 ) Zur forensisch-kasuistischen Literatur vgl. schon oben Einleitung bei N. 8; zur<br />
pragmatischen Literatur des 16. Jahrhunderts, die man früher im Anschluß an STINT-<br />
ZING zu Unrecht auch als „populäre" Literatur bezeichnete, und zur Stellung der Rezeptionsgesetze<br />
vgl. die Hinweise bei WIEGAND, Plus Petitio, §§ 4-7.<br />
6 ) Text der Reichskammergerichtsordnung von 1495, § 3 nach ZEUMER, Quellen<br />
(S- 285); fast wörtlich übereinstimmend schon im Ständischen Entwurf von 1486<br />
(ZEUMER, S. 276) und noch in der Kammergerichtsordnung von 1555 I, Tit. 13 § 1<br />
und 57.<br />
7 ) S. oben Kap. I N. 22. Die Bedeutung der Kriterien ,redlich, ehrbar' und .leidlich',<br />
die der Inhaltskontrolle dienen und sämtlich aus dem vor allem in der kanonistischen<br />
Theorie entwickelten Kriterium ,rationabilis' (dazu BRIE, Gewohnheitsrecht, S. 24 ff.,<br />
67 ff., 177ff.; L'âge classique (LEFEBVRÏ), S. 551 ff.) abgeleitet sind, haben BRIE,<br />
Rezeptionszeit, S. 148 ff., insbesondere S. 150, und TRUSEN, Partikuläres Recht,<br />
S. 103 ff., 110 ff. dargelegt.<br />
e ) Nachweise bei BRIE, Rezeptionszeit, S. 150 N. 107, S. 160 N. 151; TRUSEN,<br />
Partikuläres Recht, S. 104; s. auch unten bei N. 66 ff.<br />
•) Die Regelung galt vor allem, als unter „Germanisten" und „Romanisten" noch<br />
um die Berechtigung der Rezeption gestritten wurde, als eine der Schlüsselstellen und<br />
erschien den Rezeptionsgegnern als „Sündenfall", vgl. etwa SCHVARTZ, Zivilprozeßgesetzgebung,<br />
S. 72 ff.<br />
163