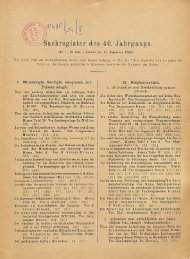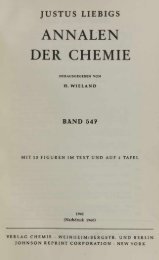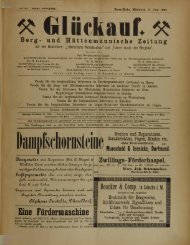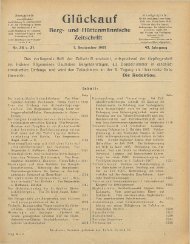B erg - und H ü ttenm ä nnische Z eitschrift Nr. 13 26. März 1927 63 ...
B erg - und H ü ttenm ä nnische Z eitschrift Nr. 13 26. März 1927 63 ...
B erg - und H ü ttenm ä nnische Z eitschrift Nr. 13 26. März 1927 63 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>26.</strong> M <strong>ä</strong>rz <strong>1927</strong> G l<strong>ü</strong> c k a u f 451niedrigem Aschengehalt der Waschb<strong>erg</strong>e weniger scharfgewaschen wird. Die Beurteilung der Waschb<strong>erg</strong>enach dem Aschengehalt ist richtig, sofern man weiß,wie weit der tats<strong>ä</strong>chliche Gehalt an unverbrennlichenStoffen, die aus den Mineralbestandteilen stammen, denAschenwert beeinflußt. Bei hochmineralhaltigen Brennstoffenist n<strong>ä</strong>mlich die Menge des Verbrennungsr<strong>ü</strong>ckstandesvon dessen chemischer Zusammensetzung inerheblichem Maße abh<strong>ä</strong>ngig. Das Entweichen vonHydratwasser aus den Tonerdesilikaten sowie vonKohlens<strong>ä</strong>ure aus den Karbonaten <strong>und</strong> Änderungender Oxydationsstufen des Eisens spielen hierbei einewichtige Rolle. Brandschiefer geben z. B. mehr fl<strong>ü</strong>chtigeBestandteile ab als die Kohlen, mit denen sie in demselbenFlöz zusammen Vorkommen. So weichen diesebei der Kokskohle <strong>und</strong> dem Mittelprodukt der ZecheConsolidation, auf Reinkohle bezogen, um 7,66 % voneinanderab, deren Herkunft augenscheinlich auf unverbrennlicheStoffe aus den Mineralbestandteilen zur<strong>ü</strong>ckzuf<strong>ü</strong>hrenist. Solange diese Größe wechselt oder nichtbekannt ist, bleibt die Beurteilung des W<strong>ä</strong>schebetriebesdurch ausschließliche Feststellung des Aschengehaltesl<strong>ü</strong>ckenhaft. Sie muß durch die Ermittlung der sichdem Waschvorgang entziehenden aufbereitungsf<strong>ä</strong>higenKohle erweitert werden, denn erst dieser Kohlenbetraggibt ein unzweideutiges Bild <strong>ü</strong>ber die Wirtschaftlichkeitder W<strong>ä</strong>sche. Festgestellt wird die Kohlenmenge nachdem Schwimm- <strong>und</strong> Sinkverfahren, d. h. durch Scheidungder Waschb<strong>erg</strong>e auf Gr<strong>und</strong> ihres spezifischenGewichtes.Bei der Anwendung des Schwimm- <strong>und</strong> Sinkverfahrensentsteht naturgem<strong>ä</strong>ß die Frage, bei welcherSchwere der abgeschiedene Anteil als Kohle oder alsGestein anzusprechen ist. Reine St<strong>ü</strong>ckkohle hat einspezifisches Gewicht von 1,2 bis 1,3. Wie englischeUntersuchungen bewiesen haben, zerf<strong>ä</strong>llt die Kohle beider mechanischen Aufbereitung in vier besondere Bestandteile— Vitrit, Clarit, Durit <strong>und</strong> Fusit — , die alleverschiedenes Gewicht haben. Aus der F<strong>ü</strong>lle der Arbeitenvon Stopes <strong>und</strong> Wheeler1, Lessing2, Sinnatt3sowie Baranov <strong>und</strong> Francis4 seien dieZahlen herausgenommen, welche die letzten beidenForscher an einer Probe geb<strong>ä</strong>ndeter bituminöser Steinkohlevon Nottinghamshire erhielten, die als qu<strong>erg</strong>emesseneS<strong>ä</strong>ule von 46 cm einen Schnitt durch dasTop-Hard-Flöz der East-Kirkby-Grube darstellte. Dievier Bestandteile fielen bei der mechanischen Aufbereitungin folgenden Mengen an: Vitrit 10°/o, Clarit12°/o, Durit 75 % <strong>und</strong> Fusit 3 % .Die bei der Untersuchung auf Dichte <strong>und</strong> Aschegef<strong>und</strong>enen Werte sind nachstehend wied<strong>erg</strong>egeben.Vitrit Clarit Durit FusitDichte . . 1,23 .1,22 1,47 1,52Asche °/0 0,90 1,30 7,80 <strong>13</strong>,80Aus der Übersicht <strong>erg</strong>ibt sich die Tatsache, daß dieKohle inhomogen zusammengesetzt ist, <strong>und</strong> daß sogarTeile mit einer Dichte von 1,52 abgesondert werden,die sich als durchaus aufbereitungsf<strong>ä</strong>higerweisen. Daherkommt f<strong>ü</strong>r das Schwimm- <strong>und</strong> Sinkverfahren zur Pr<strong>ü</strong>fungder Waschb<strong>erg</strong>e eine Scheidefl<strong>ü</strong>ssigkeit mit einem spezifischenGewicht von 1,6 in Betracht.1 Proc. Roy. Soe. 1919, Bd. 90, S. 470; Fue! 1923, S. 5; vgl. W in t e r ,Gl<strong>ü</strong>ckauf 1923, S. 873.* Trans. Inst. Min. Eng. 1921, Bd. 61, S. 36.8 Trans. Inst. Min. Eng. 1922, Bd. <strong>63</strong>, S. 307.4 Fuel 1922, S. 219.Obgleich der Gr<strong>und</strong>satz des Schwimm- <strong>und</strong> Sinkverfahrenssehr einfach ist, erfordert er doch besondersausgearbeitete Vorrichtungen, damit die erhaltenen Werteauf Zuverl<strong>ä</strong>ssigkeit Anspruch erheben können. DieseVorrichtungen sollten aber nicht nur im Aufbereitungslaboratoriumgebraucht werden, sondern auch in derW<strong>ä</strong>sche selbst, denn es ist notwendig, daß der Aufbereitungstechnikereine Selbst<strong>ü</strong>berwachung aus<strong>ü</strong>bt <strong>und</strong>Betriebsstörungen sofort aufzufinden vermag. F<strong>ü</strong>r dieseZwecke sind Analysiervorrichtungen selten anzutreffen.Der nachstehend beschriebene »Waschb<strong>erg</strong>epr<strong>ü</strong>fer« verdanktseine Durchbildung dem Wunsche, der W<strong>ä</strong>scheein einfaches Pr<strong>ü</strong>fger<strong>ä</strong>t zu geben, das nicht nur <strong>ü</strong>berden Waschverlust Auskunft gibt, sondern auch dazuverwendet werden kann, den Aschengehalt des wertvollstenErzeugnisses der W<strong>ä</strong>sche, der Kokskohle, ohneVerbrennungsanalyse im Laboratorium an Hand einerschaubildlichen Aufzeichnung mit einer Genauigkeitvon 0,5 % festzustellen.D a s Schwimm- <strong>und</strong> Sinkverfahren mitHilfe des Waschb<strong>erg</strong>epr<strong>ü</strong>fers.Aus dem b<strong>erg</strong>m<strong>ä</strong><strong>nnische</strong>n Schrifttum sind nurwenige laboratoriumsm<strong>ä</strong>ßige Vorrichtungen f<strong>ü</strong>r dieAus<strong>ü</strong>bung des Schwimm- <strong>und</strong> Sinkverfahrens bekannt.W<strong>ü</strong>ster1verwendet eine Anzahl von Kelchgl<strong>ä</strong>sern mitetwa 1000 cm3 Fassungsraum, in denen sich die Scheidefl<strong>ü</strong>ssigkeitenvon verschiedenem spezifischem Gewichtbefinden <strong>und</strong> mit deren Hilfe er die Gemengteile derKohle scheidet. Die Kohlenprobe wird in das ersteGlas eingef<strong>ü</strong>llt, die schwimmende Kohle abgeschöpft,die untersinkende in das n<strong>ä</strong>chste Glas aufgegeben usw.Es ist klar, daß durch das Abschöpfen ein Teil derKohle nied<strong>erg</strong>edr<strong>ü</strong>ckt wird, der sich somit der Analyseentzieht. Auch d<strong>ü</strong>rfte es ausgeschlossen sein, die anden Wandungen der Gl<strong>ä</strong>ser haftenbleibenden feinenKohlenteilchen abzuheben. Bei dieser Ausf<strong>ü</strong>hrungwerden daher die Werte stets zu niedrig ausfallen.Sulfrian2 benutzte bei seinen Trennungsversucheneinen großen Scheidetrichter, bei dem aber die unmittelbareEntnahme des unt<strong>erg</strong>esunkenen Teiles durch Ablassennicht möglich war, weil hierbei ein Wirbel inder Fl<strong>ü</strong>ssigkeit entstand, der eine Vermischung derbeiden Fraktionen zur Folge gehabt h<strong>ä</strong>tte, so daß zuerstder schwimmende Teil mit Hilfe eines Hebers abgelassenwerden mußte. Auch diese Vorrichtung ist f<strong>ü</strong>r eineSchnellanalyse nicht brauchbar, weil sich die Erfassungder Kohle nicht quantitativ durchf<strong>ü</strong>hren l<strong>ä</strong>ßt.Bei der wissenschaftlichen Bodenuntersuchung wirdvielfach das Scheidegef<strong>ä</strong>ß von Brögger3 (Abb. 1) verwendet.Es ist auf die Scheidung von Mineralien zugeschnitten<strong>und</strong> besteht aus einem kegelförmig zulaufendenScheidetrichter mit großem Mohrschem Hahn <strong>und</strong> einemScheiderohr mit kleinem Hahn. F<strong>ü</strong>r die Zwecke derWaschb<strong>erg</strong>epr<strong>ü</strong>fung l<strong>ä</strong>ßt sich diese Vorrichtung verwenden,wenn sie nach der Angabe des Verfassers ineinen Doppelscheidetrichter (a <strong>und</strong> b in Abb. 2) mit zweigroßen, gleichen H<strong>ä</strong>hnen c <strong>und</strong> d abge<strong>ä</strong>ndert wird. Einsolches Scheidegef<strong>ä</strong>ß hat sich durchaus bew<strong>ä</strong>hrt. Es weistjedoch den Nachteil auf, etwas lang zu sein (60 cm), sodaß die Handhabung erschwert wird. Dieser Nachteil fehltdem vom Verfasser angegebenen Scheidegef<strong>ä</strong>ß (Abb. 3),bei dem Scheideraum a <strong>und</strong> Auffanggef<strong>ä</strong>ß b auseinander-' Gl<strong>ü</strong>ckauf 1925, S. 62.1 Gl<strong>ü</strong>ckauf 1921, S. 1117.3 W a h n s c h a f f e : Anleitung zur wissenschaftlichen Bodenuntersuchung,1903, S. 79.