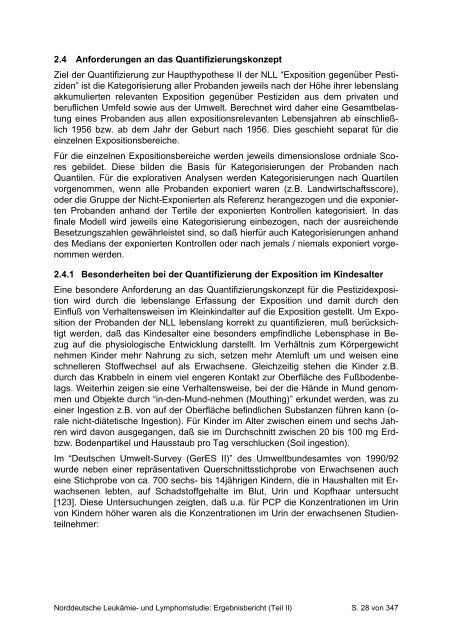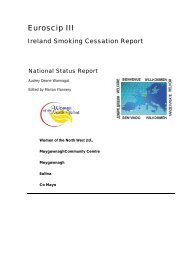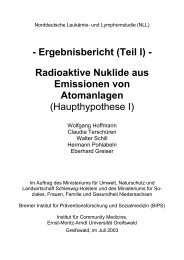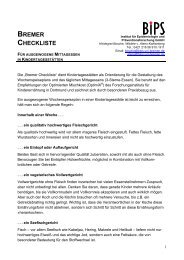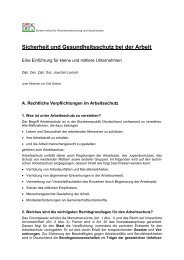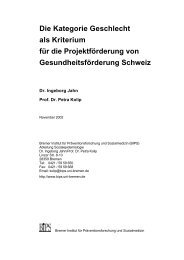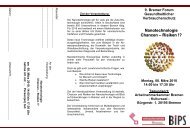- Seite 1 und 2: Norddeutsche Leukämie- und Lymphom
- Seite 3 und 4: Michael Schümann Behörde f. Arbei
- Seite 5 und 6: 2.6.5 Gewichtung anhand der behande
- Seite 7 und 8: 3.4.2 Prüfung möglicher Assoziati
- Seite 9 und 10: 5.5.1.1 Ergebnisse des finalen Mode
- Seite 11 und 12: mögliche Ursache für regionale H
- Seite 13 und 14: die Verwendung von 2,4-Dichlorpheno
- Seite 15 und 16: iziden. Für Insektizide, Fungizide
- Seite 17 und 18: tet. Auch für die chronisch lympha
- Seite 19 und 20: Eine Assoziation zwischen kindliche
- Seite 21 und 22: Regel keinen eigenen Krankheitswert
- Seite 23 und 24: - Zweck des Einsatzes, beispielswei
- Seite 25 und 26: Sensitivitätsanalyse zusätzlich h
- Seite 27: Tab. 2-2 Response bei Kontrollen ge
- Seite 31 und 32: Eine zusätzliche orale Aufnahme vo
- Seite 33 und 34: Tab. 2-4 Aufenthaltsdauer in Innenr
- Seite 35 und 36: Tab. 2-5 Verhaltensweisen von Klein
- Seite 37 und 38: Tab. 2-7 Basisvariablen für die Ex
- Seite 39 und 40: Forts. Tab. 2-7 Basisvariablen Expe
- Seite 41 und 42: Abb. 2-1 Strukturschema zur Exposit
- Seite 43 und 44: cherstäbchen) wurden von den Exper
- Seite 45 und 46: Tab. 2-11 Insektizidanwendungen: Ge
- Seite 47 und 48: Tab. 2-13 Neu eingeführte Variable
- Seite 49 und 50: Tab. 2-14 Variablen zur Erfassung d
- Seite 51 und 52: “Fingerkontakt” genannt, so da
- Seite 53 und 54: Abb. 2-2 Score für akute Expositio
- Seite 55 und 56: Tab. 2-17 Basisdaten für die Quant
- Seite 57 und 58: Forts. Tab. 2-17 Basisdaten für di
- Seite 59 und 60: 2.6.3 Anwendungshäufigkeit bei Hol
- Seite 61 und 62: Tab. 2-19 Gewichtungsfaktoren für
- Seite 63 und 64: Tab. 2-21 Neu eingeführte Variable
- Seite 65 und 66: Forts. Tab. 2-22 Neu eingeführte V
- Seite 67 und 68: Forts. Tab. 2-23 persönlicher Kont
- Seite 69 und 70: 2.6.8.2.2 Anwendung von Schutzmaßn
- Seite 71 und 72: Abb. 2-5 Score für akute Expositio
- Seite 73 und 74: 2.7 Exposition durch Anwendung von
- Seite 75 und 76: Variablenname in der Datenbank Besc
- Seite 77 und 78: zu haben, wurde der Gewichtungsfakt
- Seite 79 und 80:
2.7.4 Ermittlung der Zeiträume von
- Seite 81 und 82:
wertung einzubeziehen gewesen wäre
- Seite 83 und 84:
Tab. 2-33 Faktoren zu Gewichtung f
- Seite 85 und 86:
2.7.9.1 Multiplikative Scores für
- Seite 87 und 88:
Der numerische Wert des jeweiligen
- Seite 89 und 90:
Tab. 2-37 Rohdaten für die Quantif
- Seite 91 und 92:
Tab. 2-39 Behandlungen gegen Tierpa
- Seite 93 und 94:
2.8.4 Art der durchgeführten Behan
- Seite 95 und 96:
vorgang verbleibt keine relevante M
- Seite 97 und 98:
des über Monate hinweg wirksam sin
- Seite 99 und 100:
2.9 Exposition durch Kopflausbehand
- Seite 101 und 102:
2.10 Exposition durch Nähe zu Baum
- Seite 103 und 104:
Tab. 2-48 Gartenbau in Niedersachse
- Seite 105 und 106:
2.10.2.2 Ermittlung der Inbetriebna
- Seite 107 und 108:
Diese Gewichtung wurde für jeden A
- Seite 109 und 110:
Abb. 2-9 Bahntrassen in Norddeutsch
- Seite 111 und 112:
Von diesen 1236 Nennungen sind insg
- Seite 113 und 114:
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
- Seite 115 und 116:
4. Handelsgewächse: zu den Handels
- Seite 117 und 118:
persönliche Mitteilung, Sept. 2000
- Seite 119 und 120:
Tab. 2-54 Unvollständige GKZ in Ph
- Seite 121 und 122:
2.13 Exposition gegenüber Pestizid
- Seite 123 und 124:
in die deutsche Ausgabe der “Inte
- Seite 125 und 126:
Für die Umsetzung der Quantifizier
- Seite 127 und 128:
Für jeden kumulativen Expositionsi
- Seite 129 und 130:
2.14 Imputation bei nicht informati
- Seite 131 und 132:
3 Univariate deskriptive Ergebnisse
- Seite 133 und 134:
Die Art der bekämpften Insekten wa
- Seite 135 und 136:
unden waren (z.B. “Händewaschen
- Seite 137 und 138:
in 114 Fällen für “Flecken auf
- Seite 139 und 140:
Von 4471 Probanden haben insgesamt
- Seite 141 und 142:
3.2.1.1 Substanz / Sprühnebel eing
- Seite 143 und 144:
16 Gartenphasen (0,6%) eine Gewicht
- Seite 145 und 146:
det. Einen weiteren modifizierenden
- Seite 147 und 148:
Basis für diese Korrelationen bild
- Seite 149 und 150:
Tab. 3-19 Spearman's Rangkorrelatio
- Seite 151 und 152:
Abb. 3-3 Korrelation zwischen akute
- Seite 153 und 154:
Abb. 3-6 Korrelation zwischen akute
- Seite 155 und 156:
Tab. 3-21 Spearman's Rangkorrelatio
- Seite 157 und 158:
Tab. 3-23 Spearman's Rangkorrelatio
- Seite 159 und 160:
Abb. 3-9 Korrelation der akuten Exp
- Seite 161 und 162:
Abb. 3-12 Verteilung der Exponierte
- Seite 163 und 164:
Abb. 3-15 Verteilung der Exponierte
- Seite 165 und 166:
Abb. 3-19 Verteilung akute, lebensl
- Seite 167 und 168:
Abb. 3-21 Verteilung der Exponierte
- Seite 169 und 170:
Abb. 3-24 Verteilung der Exponierte
- Seite 171 und 172:
3.6 Behandlungen gegen Tierparasite
- Seite 173 und 174:
Tab. 3-26 Behandlung gegen Kopfläu
- Seite 175 und 176:
Abb. 3-28 Verteilung der Exposition
- Seite 177 und 178:
4 Ergebnisse der multivariaten Risi
- Seite 179 und 180:
Die Modelle für akute und chronisc
- Seite 181 und 182:
Bei den Analysen für ALL bei unter
- Seite 183 und 184:
Tab. 4-1 Quantile für Erwachsene -
- Seite 185 und 186:
Forts. Tab. 4-2 B. Confounder sozia
- Seite 187 und 188:
Forts. Tab. 4-3 B. Confounder sozia
- Seite 189 und 190:
4.5.2 Nicht-lymphatische Entitäten
- Seite 191 und 192:
Tab. 4-5 Finales Modell Pestizide (
- Seite 193 und 194:
10 1 0,1 Insekt. (akute Exp.) Nicht
- Seite 195 und 196:
Forts. Tab. 4-6 B. Confounder sozia
- Seite 197 und 198:
Forts. Tab. 4-7 B. Confounder sozia
- Seite 199 und 200:
4.6.2 Akute nicht-lymphatische Leuk
- Seite 201 und 202:
Tab. 4-9 Finales Modell Pestizide (
- Seite 203 und 204:
10 1 0,1 Insekt. (akute Exp.) Nicht
- Seite 205 und 206:
Forts. Tab. 4-10 B. Confounder sozi
- Seite 207 und 208:
Forts. Tab. 4-11 B. Confounder sozi
- Seite 209 und 210:
4.6.4 Plasmozytom, Multiples Myelom
- Seite 211 und 212:
Tab. 4-13 Finales Modell Pestizide
- Seite 213 und 214:
10 1 0,1 Insekt. (akute Exp.) Nicht
- Seite 215 und 216:
Forts. Tab. 4-14 B. Confounder sozi
- Seite 217 und 218:
Forts. Tab. 4-15 B. Confounder sozi
- Seite 219 und 220:
4.6.6 Hoch maligne Non-Hodgkin-Lymp
- Seite 221 und 222:
Tab. 4-17 Finales Modell Pestizide
- Seite 223 und 224:
10 1 0,1 Insekt. (akute Exp.) Nicht
- Seite 225 und 226:
tegorisiert. Das finale Modell für
- Seite 227 und 228:
4.8 Aggregationsebene II 4.8.1 Lymp
- Seite 229 und 230:
Tab. 4-20 Finales Modell Pestizide
- Seite 231 und 232:
10 1 0,1 Insekt. (chron. Exp.) Nich
- Seite 233 und 234:
Forts. Tab. 4-21 B. Confounder sozi
- Seite 235 und 236:
Forts. Tab. 4-22 B. Confounder sozi
- Seite 237 und 238:
4.9 Aggregationsebene I 4.9.1 Akute
- Seite 239 und 240:
10 1 0,1 10 1 0,1 Insekt. (chron. E
- Seite 241 und 242:
Forts. Tab. 4-25 B. Confounder sozi
- Seite 243 und 244:
Forts. Tab. 4-26 B. Confounder sozi
- Seite 245 und 246:
4.9.2 Chronische nicht-lymphatische
- Seite 247 und 248:
Tab. 4-28 Finales Modell Pestizide
- Seite 249 und 250:
10 1 0,1 Insekt. (chron. Exp.) Nich
- Seite 251 und 252:
Forts. Tab. 4-29 B. Confounder sozi
- Seite 253 und 254:
Forts. Tab. 4-30 B. Confounder sozi
- Seite 255 und 256:
4.9.4 Plasmozytom, Multiples Myelom
- Seite 257 und 258:
Tab. 4-32 Finales Modell Pestizide
- Seite 259 und 260:
10 1 0,1 Insekt. (chron. Exp.) Nich
- Seite 261 und 262:
Forts. Tab. 4-33 B. Confounder sozi
- Seite 263 und 264:
Forts. Tab. 4-34 B. Confounder sozi
- Seite 265 und 266:
4.9.6 Hoch maligne Non-Hodgkin-Lymp
- Seite 267 und 268:
Tab. 4-36 Finales Modell Pestizide
- Seite 269 und 270:
10 1 0,1 Insekt. (chron. Exp.) Nich
- Seite 271 und 272:
Die Risikoschätzer für Kopflausbe
- Seite 273 und 274:
0,0093) ist, liegt bei den Frauen d
- Seite 275 und 276:
5.1.8 Zusammenfassung der Ergebniss
- Seite 277 und 278:
5.2.3 Einzelentitäten der Aggreagt
- Seite 279 und 280:
Die Risikoschätzungen für den auf
- Seite 281 und 282:
5.5.1 Finales Modell Pestizide (aku
- Seite 283 und 284:
Tab. 5-2 Finales Modell Pestizide (
- Seite 285 und 286:
10 1 0,1 Insekt. (akute Exp.) Nicht
- Seite 287 und 288:
Forts. Tab. 5-3 B. Confounder sozia
- Seite 289 und 290:
Forts. Tab. 5-4 B. Confounder sozia
- Seite 291 und 292:
Für die Insektizide werden für di
- Seite 293 und 294:
Unterschiede wurden für weitere, e
- Seite 295 und 296:
terviewte Fälle und Kontrollen (in
- Seite 297 und 298:
Für die Ermittlung der lebenslange
- Seite 299 und 300:
Tab. 5-8 Lymphatische Entitäten (L
- Seite 301 und 302:
Tab. 5-10 Nicht-lymphatische Entit
- Seite 303 und 304:
Studie durchgeführt. Die relativ h
- Seite 305 und 306:
Um die durchschnittliche Anwendungs
- Seite 307 und 308:
Tab. 5-15 Lymphatische Entitäten (
- Seite 309 und 310:
Tab. 5-17 Nicht-lymphatische Entit
- Seite 311 und 312:
5.7.3 Schlußfolgerung zur Einbezie
- Seite 313 und 314:
Tab. 5-19 Lymphatische Entitäten (
- Seite 315 und 316:
Tab. 5-21 Nicht-lymphatische Entit
- Seite 317 und 318:
5.9 Wertung der Ergebnisse der NLL
- Seite 319 und 320:
5.10 Diskussion vor dem Hintergrund
- Seite 321 und 322:
wohnten. Die Konzentrationen für D
- Seite 323 und 324:
sie ist es besonders wichtig, dass
- Seite 325 und 326:
Zur Durchführung von Subgruppenana
- Seite 327 und 328:
Art der Behandlung (Flohhalsband, S
- Seite 329 und 330:
Frauen für Holzschutzmittel im chr
- Seite 331 und 332:
7 Literatur 1. Raspe H, Kohlmann T,
- Seite 333 und 334:
24. Bode LE. Agricultural chemical
- Seite 335 und 336:
48. Hardell L, Eriksson M, Lenner P
- Seite 337 und 338:
73. Hostrup O, Witte I, Hoffmann W,
- Seite 339 und 340:
97. Pogoda JM, Preston-Martin S. Ho
- Seite 341 und 342:
121. Statistisches Bundesamt, Hrsg.
- Seite 343 und 344:
144. Bundesinstitut für gesundheit
- Seite 345 und 346:
168. Bond GG, Bodner KM, Sobel W, S
- Seite 347:
192. Lu C, Fenske RA, Simcox NJ, Ka