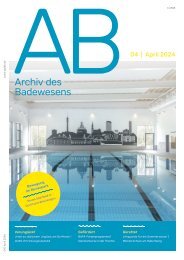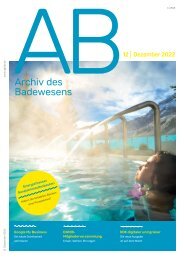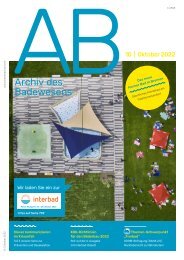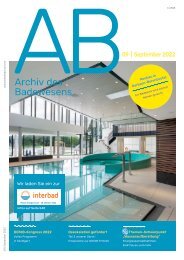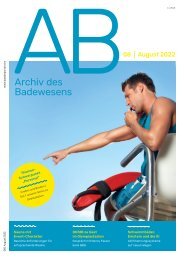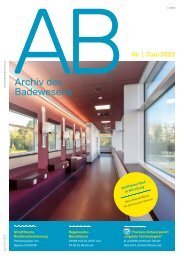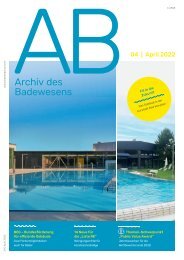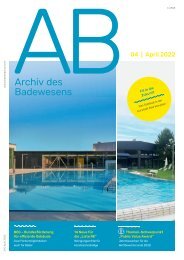2018-11-00
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Planung · Bäderbau | AB Archiv des Badewesens <strong>11</strong>/<strong>2018</strong> 650<br />
Grundlagen zum sommerlichen Wärmeschutz<br />
Ziele und Anforderungen nach der DIN 4108-2 und der Energieeinsparverordnung<br />
Dr.-Ing. Thomas Duzia, Dipl.-Ing. Architekt, duzia bauphysik+architektur, Wuppertal, Obmann des Arbeitskreises Energie und Ressourcen der<br />
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V., Essen<br />
Mit der Einführung der Energieeinsparverordnung<br />
(EnEV) wurde auf<br />
der Grundlage des § 4, Anforderungen<br />
an Nichtwohngebäude, auch der<br />
Nachweis zum sommerlichen Wärmeschutz<br />
verpflichtend, um auch den<br />
Energieaufwand zur Kühlung von Gebäuden<br />
zu berücksichtigen und mittels<br />
passiver Maßnahmen zu reduzieren.<br />
Der Nachweis erfolgt im Sonneneintragskennwerte-Verfahren<br />
auf der<br />
Grundlage der DIN 4108-2, die den<br />
Mindestwärmeschutz regelt, und die<br />
zu den bauaufsichtlich eingeführten<br />
Normen zählt. Aufgrund der Besonderheiten<br />
des Schwimmbadbaues stellt<br />
sich jedoch die Frage, ob der normative<br />
Rechenweg und die Vorgaben an<br />
die einzuhaltenden Innenraumtemperaturen<br />
überhaupt auf Hallenbäder<br />
anzuwenden sind.<br />
Eine hohe und direkte Sonneneinstrahlung<br />
führt bei großflächig verglasten<br />
Gebäuden zu hohen Temperaturen im<br />
Innenraum. Diese beeinträchtigen die<br />
Behaglichkeit des Gastes und senken<br />
zugleich die Leistungsfähigkeit von<br />
Mitarbeitern. Um diesen Effekten entgegenzuwirken<br />
und den Energieaufwand<br />
zur Sicherstellung der Aufenthaltsqualität<br />
nicht durch aktive Kühlmaßnahmen<br />
zu erhöhen, gibt der normative<br />
Rechenweg auf der Grundlage<br />
der DIN 4108-2 eine einfache Methode<br />
zur Bilanzierung des sommerlichen<br />
Aufwärmverhaltens bei Räumen in<br />
Wohn- und Nichtwohngebäuden vor.<br />
Aus wirtschaftlicher Sicht kann der<br />
energetische Aufwand für die Gebäudekühlung<br />
bei großflächig verglasten<br />
Gebäuden durchaus die Kosten für den<br />
Heizwärmebedarf übersteigen, wie es<br />
der Betriebskostenvergleich in Abbildung<br />
1 aus dem Leitfaden Nachhaltiges<br />
Bauen 1) zeigt. Somit helfen passive<br />
bauliche Maßnahmen, die Betriebskosten<br />
zu reduzieren und den Kühlbedarf<br />
zu senken.<br />
Einflussfaktor Strahlungseintrag für<br />
das Aufheizen eines Raumes<br />
Einen entscheidenden Einfluss auf die<br />
Wärmeentwicklung im Rauminneren<br />
hat die eintreffende Sonnenstrahlung.<br />
Je höher die äußere, auf das Gebäude<br />
einwirkende Belastung durch Strahlung<br />
ist, umso wichtiger sind Schutzmaßnahmen,<br />
die den Einfluss der solaren<br />
Strahlung und den daraus resultierenden<br />
Treibhauseffekt – die Erwärmung<br />
im Innenraum – reduzieren.<br />
j Abbildung 1: Betriebskosten im Vergleich; dargestellt sind die Minimal- und Maximalwerte 1)