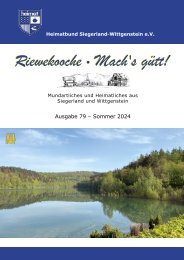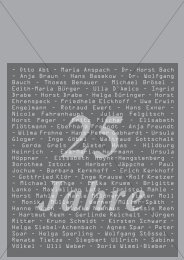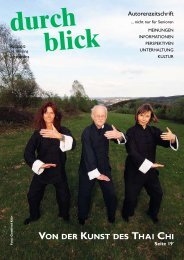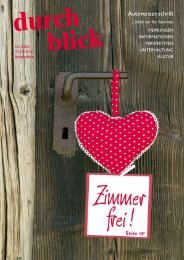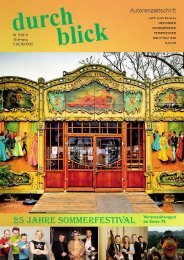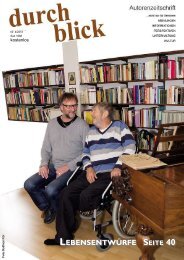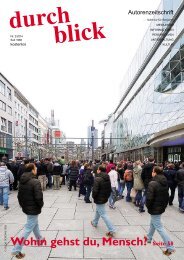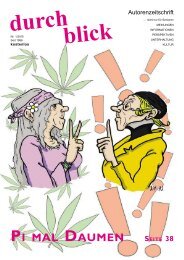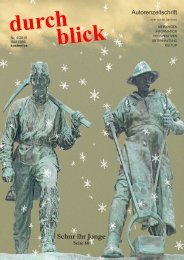db 2020-4 WEB
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gesellschaft
Etwas über Ehen,
die im Himmel geschlossen werden
Es gab einmal eine Zeit, da suchte man zur Eheschließung
keineswegs ein Standesamt auf. Es gab nämlich
noch gar keines. Die Trauzeremonie fand in aller Regel
in der Kirche statt. Und zwar schon seit vielen Jahrhunderten.
Pastoren und Priester vollzogen sowohl Vermählungen
als auch Taufen und Beerdigungen. In Kirchenbüchern
wurden entsprechende Eintragungen handschriftlich nach
der zeitlichen Abfolge der Ereignisse niedergeschrieben.
Wer heutzutage Ahnenforschung betreibt, für den liefern in
der Regel die in den Pfarrämtern verwahrten Aufzeichnungen
die einzigen Zeugnisse über die Vorfahren.
Die einschneidende Änderung erfolgte am 6. Februar
1875. An diesem Tag wurde ein Gesetz verkündet, das mit
den Worten „Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher
Kaiser, König von Preußen etc. verordnen…“ begann. Gleich
im Paragraph 1 wurde die Neuerung benannt: „Die Beurkundung
der Geburten, Heirathen und Sterbefälle erfolgt ausschließlich
durch die vom Staate bestellten Standesbeamten
mittels Eintragung in die dazu bestimmten Register.“ Das
Gesetz wurde am 1. Januar 1876 gültig.
Man kann sich gut vorstellen, dass die Kirchenoberen
zunächst mit Bestürzung auf die Neuerung reagierten. Ganz
gewiss waren auch die Gläubigen völlig verunsichert. Eine
Hochzeit ohne „Ja-Wort“ in einer festlich geschmückten Kirche
– das war doch gar nicht vorstellbar. Die feierlichen Handlungen
im Gotteshaus, die vollzählig anwesenden Hochzeitsgäste
und vor allem der erteilte Segen Gottes für die Ehe des
Foto: wikipedia commons
Foto: IStock
frisch getrauten Paars – das alles sollte wegfallen? „Nein!“,
sagten die weitaus meisten und seitdem feierten Christen in
Deutschland zweimal Hochzeit. Und dabei galt die auf dem
Standesamt als aufgenötigte und stilwidrige Formalie – die
in der Kirche hingegen wurde von den Gläubigen wie seit eh
und je als die „einzig richtige“ Trauung angesehen.
In dem 1963 aufgelegten Buch „Leben und Gebräuche im
Netpherland um 1900“ ist ausführlich dargelegt, wie die Netpherländer
damals ihr Leben gestalteten. Der Verfasser, Wilhelm
Weyer (1891 – 1971), stammte aus Dreis-Tiefenbach.
Ab 1946 leitete er drei Jahre lang das Siegener Stadtarchiv, die
städtischen Büchereien und überdies das Siegerland-Museum
im Oberen Schloss. Als „Dreisber“ – wie er sich oft und gerne
selbst bezeichnete – hatte der Doktor der Philosophie naturgemäß
die bestmögliche Eignung
für die Erstellung dieser Abhandlung.
In Westfalen wird man lange
suchen müssen, um eine ähnlich
ausführliche volkskundliche Darstellung
zu finden. Der Inhalt ist –
mit Ausnahme der mundartlichen
Untersuchungen – ganz bestimmt
auch für die Nachbarregionen des
Johannlands gültig.
Für den Ihnen vorliegenden
Aufsatz bietet das Kapitel „Verlobung
und Ehe“ die besten Wilhelm Weyer
Einblicke
in die Zeit, in der die Trauungen auf dem Standesamt
noch etwas Neues waren. Und gleich die ersten Sätze
überraschten mich ein wenig: „Bei den … Möglichkeiten
des Zusammentreffens junger Menschen beiderlei Geschlechts
kam es auch mal zu einer festen Bindung. Im
Allgemeinen war eine echte Jugendliebe selten.“ Und etwas
später liest man: „Man zeigte seine Gefühle nicht, die
meisten hatten wohl auch keine innigeren, wärmeren …
und ließen die gröberen erst mit der bevorstehenden Ehe
aufkommen, die, wie es im Ablauf des Lebens üblich war,
zu ihrer Zeit geschlossen wurde, offenbar ohne drängende,
zwingende Empfindungen.“
Überrascht war ich vor allem deshalb, weil in den Büchern
aus früheren Zeiten vielmals von Liebesbeziehungen
zwischen jungen Menschen zu lesen ist. Nicht zuletzt Jung-
Stilling fesselte die Leser schon im 18. Jahrhundert mit seiner
romantischen Erzählung „Florentin und Rosemarie von
Fahlendorn“ und dem hierin beschriebenen Schicksal zweier
jugendlicher Liebenden. Und bei uns sollte eine Jugendliebe
etwas Seltenes gewesen sein? Bei näherer Betrachtung
wurde mir freilich klar, dass die Erzähler in den verflossenen
Zeiten mit wenigen Ausnahmen die Lebensweise gut
Betuchter in den Städten, oft auch die Geschicke Adliger
auf ihren Gutshöfen, zu Papier brachten. Weyer hingegen
beschrieb anschaulich, dass er in den kleinen Siegerländer
Ortschaften etwas anderes erfahren hatte, nämlich eine unverkennbare
„Kühle der Gefühle“.
Diese scheinbare Gefühllosigkeit prägte laut Weyer auch
das gemeinsame Leben: „Nie sah man bei den Eltern eine
Berührung oder hörte ein zärtliches Wort. Die Ehe stellte
sich – wenigstens nach außen hin – als eine ausschließlich
praktische Lebensgemeinschaft dar.“ Die Eheschließung
selbst war für die weitaus meisten dennoch das unübertroffene
Geschehnis ihres Erdendaseins. Es blieb immerwährend
in schönster Erinnerung. Weyer: „Die Mädchen hielten
streng darauf, mit dem Brautkranz und die jungen Männer
mit dem Myrtensträußchen vor den Traualtar zu treten. Eine
unter Druck geschlossenen Ehe wurde von der ganzen Familie
als eine Schande und ein Unglück empfunden. Die
Kirche hielt strenge Zucht. Wer den Pfarrer im Traugespräch
belogen hatte, wurde im Gottesdienst bekanntgegeben und
eine gewisse Zeit nicht zu den Sakramenten zugelassen.“
Häufig kam es vor, dass junge Leute selbst keine Frau
oder keinen Mann finden konnten. Oft wurden in diesen
Fällen die Eltern als Vermittler tätig. Diese wussten ja am
besten, was für ihre Kinder von Vorteil sein würde. In den
beteiligten Familien achtete man sehr darauf, dass der vorhandene
Grundbesitz nicht zu stark voneinander abwich.
Dass eine Heirat gegen den Willen der Eltern zustande
kam, galt als unliebsame Ausnahme.
Hochzeit gefeiert wurde für gewöhnlich nach der Militärzeit
des Mannes. Da hatten die Bräute schon tüchtig vorgesorgt,
hatten ihre „Brautkiste“ mit der Wäscheaussteuer
gefüllt, das selbst gesponnene Leinen und alle eigens für
diesen Zweck erhaltenen Geschenke dazu gepackt.
Foto: Archiv Weber
Sehr schlicht ging es bei Kriegshochzeiten zu.
Unter den Bräuchen, die sich rund um das Heiraten drehten,
erregte das „Blatze“ das meiste Aufsehen. Hierunter
verstand man das schallende Knallen mit Peitschen. Die
Junggesellen eines Ortes passten auf, wenn ein vermuteter
Bräutigam das erste Mal das Haus seiner Braut aufsuchte.
Sie versammelten sich vor dem Gebäude und machten
durch einen kräftigen Lärm das Geschehen ortskundig. Der
Freier „revanchierte“ sich durch ein Geldgeschenk, mit dem
die Peitschenknaller ins Wirtshaus zogen. In manchen Orten
wurde auch anlässlich der Verlobung oder ein paar Tage
vor der Hochzeit „geblatzt“. Auch die Schulkinder zogen
ihren Vorteil aus der Heirat. Sie spannten paarweise mehrere
kurze Stricke vor der Kirchentüre auf und ließen diese
erst fallen nachdem sie vom Bräutigam, manchmal auch
von den Trauzeugen, eine Handvoll Münzen als Wegzoll in
die Hand gedrückt bekamen. Erwähnt werden soll auch ein
höchst herzloser Brauch, der bei passender Gelegenheit zur
Anwendung kam. Wenn die Braut vor der Trauung sichtbar
an Gewicht zugelegt hatte, dann stützten die jungen Männer
den Kasten, in dem das Aufgebot hing, mit einer größeren
Anzahl Holzbalken ab und gaben damit kund, dass die
Hochzeit „unter Druck“ geschlossen wurde.
In meinem Bücherbestand befindet sich ein Heft von
Ernst Modersohn (1870 – 1948). Vor der Jahrhundertwende
wirkte er einige Jahre als Pfarrer in Weidenau. Als Evangelist
und als erfolgreicher Schriftsteller wurde er später in
ganz Deutschland bekannt. Das Büchlein trägt den Titel:
„Christliche Liebeskunst – Was ein Vater seiner Tochter am
Hochzeitsmorgen sagt.“ Beschrieben wird mit einfachen
Worten, wie eine „gottgewollte Ehe“ zu „einem Stück Himmel
auf Erden“ wird. Ich möchte nachstehend einige Passagen
zitieren, mit denen der Verfasser vor einem Jahrhundert
in den großen Städten wohl hier und da mächtig angeeckt
wäre (vielleicht auch angeeckt ist). Schließlich erlebten in
jenen Tagen die Themen „Frauenrechte“ und „Gleichstellung
der Geschlechter“ ihre ersten Höhepunkte. In unserer
Region hingegen entsprachen seine Aussagen wohl ziemlich
genau der Denkweise nicht nur der Männer. Ich bin
mir sicher, dass auch die damals lebenden Frauen den
28 durchblick 4/2020 4/2020 durchblick 29