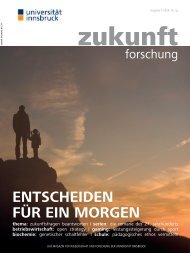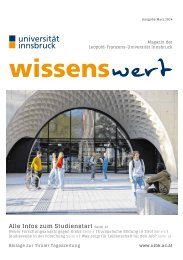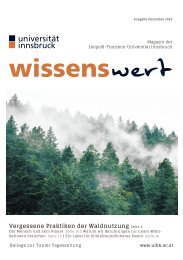Zukunft Forschung 02/2023
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
TITELTHEMA<br />
das massive Artensterben, das wir auch in<br />
Bächen und Flüssen sehen, ist der Habitatsverlust.<br />
Wir nehmen uns einfach zu viel Lebensraum.<br />
Die Folgen der menschgemachten<br />
Klimakrise zeigen sich aber auch zunehmend<br />
als Ursache für Biodiversitätsverlust und<br />
Artensterben. Fließgewässer werden durch<br />
steigende Temperaturen wärmer mit entsprechenden<br />
Folgen für viele Lebewesen, aber<br />
die noch viel wichtigere Konsequenz ist die<br />
damit verbundene Veränderung der Abflussregime.<br />
Wir wissen, dass Extremereignisse<br />
zunehmen werden. Diese Ereignisse nehmen<br />
Einfluss auf die Störungsdynamik, aber auch<br />
auf die Dynamik, mit der ein gerade gestörter<br />
Lebensraum durch Organismen aus der<br />
Umgebung wiederbesiedelt werden kann: In<br />
fragmentierten Gewässernetzwerken können<br />
sich Habitate nach Extremereignissen nur<br />
noch schlecht oder gar nicht mehr erholen.<br />
Das heißt, Lebewesen sterben an einer Stelle<br />
ab, aber durch die fehlende Konnektivität zu<br />
Quellpopulationen – sofern diese nicht ohnehin<br />
auch in Mitleidenschaft gezogen wurden<br />
– kommt kein neues Leben nach.<br />
ZUKUNFT: Welche Folgen haben diese Veränderungen?<br />
SINGER: Wenn das Abflussregime eines Flusses<br />
umgestaltet wird, treten die Auswirkungen<br />
nicht nur an der Stelle des Eingriffs auf,<br />
sondern erstrecken sich über große Bereiche<br />
des Netzwerkes. Das liegt daran, dass der<br />
Austausch von Arten wie auch der Transport<br />
von Ressourcen beeinträchtigt werden.<br />
Die besondere Struktur der Verbindungen<br />
zwischen den verschiedenen Lebensräumen<br />
ist es, die Flussökosysteme zu solch artenreichen<br />
Umgebungen macht. Wir messen in<br />
Fließgewässern, korrekterweise in Binnengewässern<br />
– gemeinsam mit Seen – eine höhere<br />
Artendichte, also mehr Arten pro Fläche, als<br />
in terrestrischen und marinen Lebensräumen.<br />
Wir beobachten in Binnengewässern<br />
aber auch das schnellste Artensterben. Das<br />
liegt einerseits am Lebensraumverlust und<br />
andererseits an der Verringerung der Vielfalt<br />
der Lebensräume in Fließgewässern durch<br />
ihre „Zähmung“. Teilweise vermuten wir,<br />
dass die derzeit bereits bestehende Fragmentierung<br />
von Flussnetzwerken eine sogenannte<br />
Aussterbensschuld bedingt. Das heißt, wir<br />
rechnen auch bei Aufrechterhaltung des Status<br />
quo mit einem weiteren Verlust an Arten<br />
in der nahen <strong>Zukunft</strong>. Biologische Systeme<br />
reagieren zeitverzögert.<br />
ZUKUNFT: Sie sprechen von vielen bereits unumkehrbaren<br />
Konsequenzen. Welche Schutzmöglichkeiten<br />
gibt es dann noch?<br />
SINGER: Die Biodiversitätskrise und damit<br />
verbunden die Klimakrise werden andere<br />
Ökosysteme und Landschaften schaffen, aber<br />
nicht „keine“. Insofern lässt sich daraus keine<br />
Billigung von Naturzerstörung ableiten.<br />
Unsere Abhängigkeit von funktionierenden<br />
Ökosystemen und Biodiversität wird nicht<br />
verschwinden, wenn der Klimawandel seine<br />
Spur der Zerstörung zieht. Wir sind gut beraten,<br />
Ökosysteme so gut es geht in einem natürlichen<br />
Zustand zu bewahren, weil dieser<br />
„Die Bemühungen rund um Renaturierungen von Fließgewässern<br />
sind inzwischen an vielen Orten zu beobachten und natürlich zu<br />
begrüßen. Aber ich glaube dennoch, dass es wichtig wäre zu<br />
verstehen, dass Systeme, die jetzt noch intakt sind, intakt bleiben<br />
müssen. Wenn also an Ort A etwas demoliert wird und dafür an<br />
Ort B renaturiert, gleicht das diese Eingriffe in die Natur nicht aus.“<br />
<br />
Gabriel Singer, Institut für Ökologie<br />
Zustand die größtmögliche Resilienz bedeutet.<br />
Aus einem Gletscherbach wird ein nicht<br />
minder wichtiger Bergbach werden. Anpassungsfähigkeit<br />
ist in Zeiten des Klimawandels<br />
ein sehr hohes Gut. Daher ist es wichtig<br />
die bestehende Restwildnis an Lebensräumen<br />
im Wasser und an Land möglichst zu erhalten.<br />
Der Erhalt der Biodiversität ist unsere<br />
Versicherung, da intakte Systeme mit diesen<br />
Konsequenzen besser umgehen können. Ich<br />
kann als Ökologe nur immer wieder betonen,<br />
dass unser Überleben als Menschen davon abhängt,<br />
die Biodiversität zu erhalten.<br />
ZUKUNFT: Es werden zunehmend Renaturierungsmaßnahmen<br />
im Bereich von Flüssen<br />
und Bächen durchgeführt oder sind geplant,<br />
auch in Tirol. Ist das der richtige Weg?<br />
SINGER: Die Bemühungen rund um Renaturierungen<br />
von Fließgewässern sind inzwischen<br />
an vielen Orten zu beobachten und natürlich<br />
zu begrüßen. Und den Studierenden<br />
sage ich auch gerne, dass wir ohnehin in das<br />
Zeitalter der Renaturierung eintreten müssen,<br />
um dem Artensterben zu begegnen, sie sich<br />
also auch über ihre beruflichen Aussichten keine<br />
Sorgen machen sollten. Aber ich glaube<br />
dennoch, dass es wichtig wäre, zu verstehen,<br />
dass Systeme, die jetzt noch intakt sind, intakt<br />
bleiben müssen. Wenn also an Ort A etwas demoliert<br />
wird und dafür an Ort B renaturiert,<br />
gleicht das diese Eingriffe in die Natur nicht<br />
aus. Das ist aus ökologischer Sicht nicht möglich.<br />
Aus dem Artenschutz wissen wir, dass es<br />
sehr viel einfacher ist, ein intaktes System zu<br />
schützen als ein kaputtes zu reparieren. Der<br />
erste Schritt sollte künftig immer sein, intakte<br />
Systeme in Frieden zu lassen. mb<br />
PODCAST<br />
Gabriel Singer, Universitätsprofessor<br />
für Aquatische<br />
Biogeochemie, war zu Gast im<br />
Podcast der Universität Innsbruck,<br />
„Zeit für Wissenschaft“:<br />
Im ausführlichen Gespräch erzählt<br />
er mehr über seine Arbeit<br />
in der Natur und im Labor, die<br />
Bedeutung von Wissenschaftskommunikation<br />
und Engagement<br />
im Umweltschutz – und<br />
was vom Kajakfahren<br />
für die <strong>Forschung</strong> gelernt<br />
werden kann.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 11