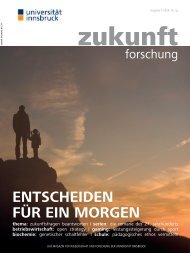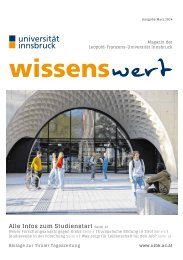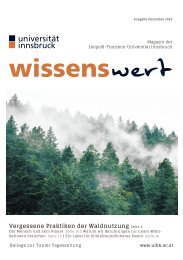Zukunft Forschung 02/2023
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TITELTHEMA<br />
GRENZFLUSS: Auf Basis dieser Karte sollten<br />
die Archen- und Territorialkonflikte zwischen<br />
Bayern und Tirol geschlichtet und ein Verbauungsplan<br />
entworfen werden. Der ideale,<br />
begradigte Verlauf des Inns ist mit gelber<br />
Farbe vorweggenommen (Oberarcheninspektor<br />
Franz Anton Rangger, 1746).<br />
ging es in erster Linie um Hochwasserschutz,<br />
weiters um Anbauflächen. Diese<br />
Interessen kollidierten: Die Schifffahrt<br />
benötigte eine „geradlinige“ Verbauung,<br />
die Gemeinden favorisierten sogenannte<br />
„Wurfarchen“. Quer in den Fluss hineingebaute<br />
Dämme, welche die eigene Uferseite<br />
vor Überschwemmung schützten,<br />
weil sie das Flusswasser auf die andere<br />
Uferseite „warfen“. Verständlich, dass<br />
davon betroffene Gemeinden auf der<br />
anderen Flussseite ähnlich agierten. „Archenkriege“<br />
dieser Art gab es nicht nur<br />
zwischen Gemeinden – etwa zwischen<br />
Kolsass, Weer und Terfens – sondern<br />
auch zwischen Tirol und Bayern. „Seit<br />
1504 war ab Kufstein der Inn die Grenze.<br />
Schon wenige Jahre später begannen<br />
Konflikte, da sich der Verlauf des Inns<br />
immer wieder veränderte. Einmal leitete<br />
diese Seite, einmal die andere den Fluss<br />
um“, schildert Nießner. „Der Bau von<br />
Wurfarchen war den Gemeinden zwar<br />
verboten, fand aber statt. Und waren sie<br />
einmal gebaut, hatten sie große Auswirkungen<br />
und waren nicht so leicht rückzubauen“,<br />
erklärt der Historiker. Insofern,<br />
so Nießner, war der Inn schon zu<br />
Ranggers Zeiten nicht mehr durchgehend<br />
naturbelassen: „Wurfarchen trugen zum<br />
Mäandern des Inns bei. Auch bei Brücken<br />
musste das Flussbett verengt werden.“<br />
Stellen hingegen, an denen Wildbäche<br />
in den Inn mündeten und viel Geschiebe<br />
einbrachten, mussten immer wieder verbreitert<br />
werden. „Dort, wo der Vomper<br />
Bach und der Pillbach in den Inn fließen,<br />
halbierte sich die Flussbreite durch das<br />
Geschiebe, was die Fließgeschwindigkeit<br />
erhöhte und für die Schifffahrt problematisch<br />
war“, erzählt Nießner.<br />
Überschwemmungen<br />
Doch Oberarcheninspektor Rangger<br />
hatte nicht nur die Schifffahrt im Auge.<br />
Auf den 120 Flusskilometern zwischen<br />
Pettnau und Bayern wollte er 450 Hektar<br />
„öder Gründe“ in landwirtschaftlich<br />
nutzbare Fläche verwandeln. „Die Steigerung<br />
des Anbaus war ein zentrales Motiv“,<br />
sagt Nießner, war Tirol, das sich aufgrund<br />
klimatischer und geografischer Bedingungen<br />
nicht selbst versorgen konnte,<br />
doch auf Importe angewiesen. Weiters<br />
erhoffte sich die Wasserbaubehörde von<br />
der Eindämmung des Inns einen verbesserten<br />
Schutz gegen Hochwasser. Wobei<br />
ein Blick auf die Hochwasserereignisse<br />
der damaligen Zeit zeigt, dass viele erst<br />
durch die Nutzung des Flusses, durch<br />
gebaute Infrastrukturen und intensiven<br />
Holzschlag zur Katastrophe führten. In<br />
Inns bruck kam es 1749, 1762, 1772, 1776<br />
und 1789 zu schweren Überschwemmungen<br />
mit zahlreichen Toten. Der Inn führte<br />
zu dieser Zeit dermaßen viel Wasser, dass<br />
er den „ärarischen Holzplatz“ (wo sich<br />
heute die Universitätsgebäude am Innrain<br />
befinden) überschwemmte und das<br />
dort gelagerte Bau- und Brennholz mit<br />
sich riss. Das Holz verkeilte sich an der<br />
Innbrücke, als Folge stand die Innenstadt<br />
unter Wasser.<br />
Anteil an Hochwasserereignissen hatten<br />
aber auch Wildbäche. Diese führten,<br />
so der Eindruck der Zeitgenossen, immer<br />
mehr Geschiebe in den Inn, was zu einer<br />
Erhöhung des Flussbetts und daher zu<br />
Überschwemmungen führte. Dass dies<br />
auch mit menschlichen Handlungen zu<br />
tun hatte, wusste bereits Rangger sehr<br />
genau. Wegen des Holzschlags an steilen<br />
Berghängen in den Seitentälern kam<br />
es vermehrt zu Muren und Geschiebe,<br />
PROFIL einer frei im Wasser stehenden<br />
Arche „ohne Rücken“, d. h. ohne Uferböschung<br />
(Oberarcheninspektor Gottlieb<br />
Samuel Besser, 1783).<br />
das über die Wildbäche schließlich im<br />
Inn landete. Als Lösung für dieses Problem<br />
sah Rangger die Begradigung des<br />
Flusses. Denn durch die erhöhte Fließgeschwindigkeit<br />
hätte der Inn mehr Sediment<br />
abtransportieren können.<br />
Franz Anton Rangger sollte die Melioration<br />
des Inns nicht mehr erleben – die<br />
weitgehende Begradigung erfolgte erst<br />
im Laufe des 19. Jahrhunderts. Doch als<br />
der Inn endlich durchgehend schifffahrtstauglich<br />
war, eroberte die Eisenbahn Tirol.<br />
Für ihre Streckenführung waren weitere<br />
Flussregulierungen und -verbauungen<br />
notwendig. So wie für jene der Inntalautobahn<br />
im 20. Jahrhundert. Der heutige<br />
Verlauf des Inns ist folglich ein Abbild<br />
von Infrastruktur- und Transportprojekten<br />
dreier Jahrhunderte. ah<br />
REINHARD NIESSNER (*1988) studierte<br />
Geschichte sowie Kunst- und Kulturgeschichte<br />
an den Universitäten Augsburg,<br />
Salamanca und Montpellier. Seit 2017<br />
ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
Institut für Geschichtswissenschaften und<br />
Europäische Ethnologie an der Universität<br />
Inns bruck.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 17