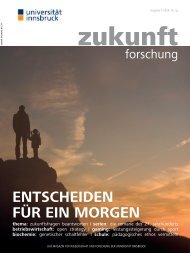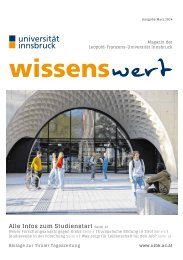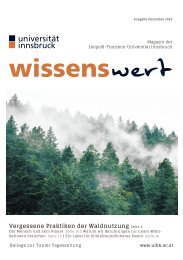Zukunft Forschung 02/2023
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ZOOLOGIE<br />
Lauren Rodriguez erinnert sich gerne<br />
an den vergangenen Juli, den<br />
sie größtenteils in einem großen,<br />
schaukelnden Schlauchboot rund um<br />
die Azoren-Inseln Pico und Faial verbracht<br />
hat. Ausgerüstet mit Kübel und<br />
Pumpe hat sie nach jeder Walsichtung<br />
zwei Mal Wasser entnommen: einmal<br />
aus dem „frischen“ Fluken-Abdruck –<br />
jener spiegelglatten Wasserfläche, die<br />
die Schwanzflosse eines Wals hinterlässt<br />
– und ein weiteres Mal rund zwanzig<br />
Minuten später. Die aus den USA stammende<br />
Nachwuchswissenschaftlerin ist<br />
PhD-Studentin im Biodiversa+-Projekt<br />
eWHALE, in dem unter Inns brucker Leitung<br />
eine neue Strategie für ein weitreichendes,<br />
nicht-invasives Walmonitoring<br />
mittels Umwelt-DNA entwickelt wird.<br />
In Zusammenarbeit mit der Walbeobachtungsagentur<br />
CW Azores und einem<br />
wissenschaftlichen Team von der Universidade<br />
dos Açores sammelte Rodriguez<br />
im Juli über 80 Wasserproben und testete<br />
dabei verschiedene Filter und Pumpen<br />
sowie die Rahmenbedingungen für die<br />
Probenentnahme an Bord. Für sie und<br />
ihre Projekt-Kolleg:innen aus Portugal,<br />
Frankreich, Italien, Irland, Norwegen<br />
und Island, vor allem aber für Projektleiterin<br />
Bettina Thalinger, Senior Scientist<br />
am Institut für Zoologie, war der vergangene<br />
Sommer sozusagen die Generalprobe<br />
für die kommende Saison. Es galt,<br />
das richtige Timing und die geeigneten<br />
Geräte für die Entnahme und Filterung<br />
des Wassers zu finden, denn 2<strong>02</strong>4 muss<br />
alles nach Plan laufen, um zusammen<br />
mit freiwilligen Helfer:innen möglichst<br />
viele Proben mit hohem Wal-DNA-Gehalt<br />
in den Meeren rund um Europa zu<br />
sammeln.<br />
Proben-Vergleich<br />
„Einmal, als ich mit dem Uni-Team unterwegs<br />
war, hatten wir besonderes Glück:<br />
Wir konnten Delfine und ihre Jungen und<br />
sogar ein Pottwal-Neugeborenes beobachten,<br />
was sehr selten ist. Am selben Tag<br />
haben wir außerdem noch Nördliche Entenwale<br />
gesehen und konnten nicht nur<br />
Wasser-, sondern auch Gewebeproben<br />
entnehmen“, erzählt Lauren Rodriguez<br />
von einem besonderen Feldforschungstag.<br />
Die Fahrten mit dem Team der Universidade<br />
dos Açores dienten vor allem<br />
der gleichzeitigen Entnahme von Gewebe-<br />
und Wasserproben. Rodriguez wird<br />
in ihrer Doktorarbeit unter anderem die<br />
Qualität der populationsgenomischen Informationen<br />
aus beiden Probenvarianten<br />
vergleichen und hat dabei Unterstützung<br />
von gleich drei wissenschaftlichen Betreuer:innen:<br />
Monica Silva von der Universidade<br />
dos Açores sowie Michael Traugott<br />
und Bettina Thalinger von der Universität<br />
Inns bruck. „Wir haben hier an der Universität<br />
Inns bruck langjährige Erfahrung<br />
in der Auswertung von Umwelt-DNA<br />
und eine hervorragende Laborinfrastruktur“,<br />
sagt Michael Traugott, Leiter<br />
der Abteilung für Angewandte Tierökologie,<br />
nicht ohne Stolz und beantwortet<br />
damit die Frage, warum eigentlich gerade<br />
eine österreichische Universität mitten in<br />
den Bergen Walforschung betreibt. „Das<br />
musste ich bei den Walbeobachtungstouren<br />
auch öfter erklären“, ergänzt Lauren<br />
Rodriguez lachend.<br />
Umweltproben als Alternative<br />
Als Umwelt-DNA (englisch: „environmental<br />
DNA“, kurz: eDNA) bezeichnet<br />
man kleinste Mengen Erbgut, die von Organismen<br />
an ihre Umgebung abgegeben<br />
werden. Das große wissenschaftliche Ziel<br />
von eWHALE ist, anhand der im Wasser<br />
enthaltenen Umwelt-DNA solide Daten<br />
zum Populationsbestand zahlreicher,<br />
teils bedrohter Wal- und Hai-Arten zu<br />
schaffen. „Bei manchen Walarten lassen<br />
sich Individuen anhand von äußerlichen<br />
Merkmalen nicht voneinander<br />
unterscheiden. Gewebeproben dürfen<br />
nur unter strengen Auflagen von <strong>Forschung</strong>steams<br />
entnommen werden, sind<br />
schwierig zu bekommen und nicht ganz<br />
unumstritten. Daher eignen sie sich nicht<br />
für ein weitreichendes Monitoring unter<br />
Einbeziehung von Walbeobachtungsanbietern<br />
und Citizen-Scientists“, erklärt<br />
Bettina Thalinger den Grund dafür. Als<br />
Expertin mit langjähriger Erfahrung in<br />
der Analyse von Umwelt-DNA mithilfe<br />
molekularer Methoden ist sie überzeugt,<br />
dass die aus dem Wasser gefilterte Wal-<br />
DNA ausreichend populationsgenomi-<br />
LAUREN RODRIGUEZ bei der Probenentnahme<br />
auf den Azoren.<br />
zukunft forschung <strong>02</strong>/23 27